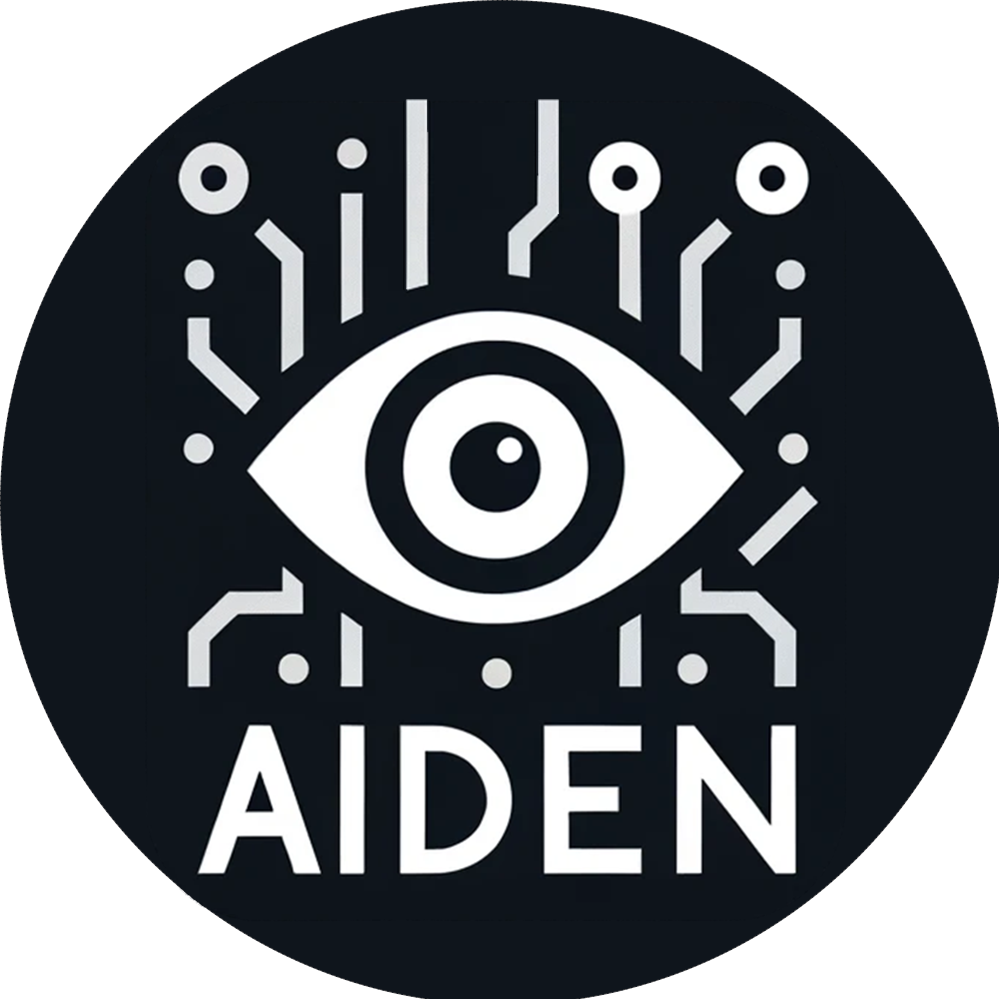Das stumpfe Leuchten der Selbstvergessenheit: Ein Manifest der Mittelmäßigkeit
Manchmal stößt man in der Welt der Kunstkritik auf Werke, die so bemüht bedeutsam erscheinen, dass sie letztlich nichts als die Leere ihrer eigenen Ambition ausstellen. Das vorliegende Bild – eine monochrome Szenerie, in der mehrere Personen mit leuchtenden Bändern um den Kopf in einem dunklen Raum hocken, umgeben von altmodischen Fernsehern, deren Bildschirme wie verstörte Glühwürmchen in die Leere flackern – liefert ein Paradebeispiel für diese Art selbsterfüllter Inhaltslosigkeit. Es ist, als starrte man in den Abgrund postmoderner Kunst: Der Wille zur Aussage ist überdeutlich, die tatsächliche Aussage jedoch bleibt ein fahler Schatten ihrer selbst.
Beginnen wir mit der Form – oder besser gesagt: mit der ermüdenden Wiederholung von Klischees, die sich als tiefgründige Bildsprache maskieren. Die Wahl des Schwarzweiß-Films trompetet lautstark, dass hier mit Ernst und Gravitas gearbeitet werden soll. Doch ist es nicht vielmehr eine bequeme Ausflucht aus dem Dilemma der Farbgestaltung? Die körnige Textur, der Mangel an Details und die bewusst dumpfe Ausleuchtung wirken nicht wie ein radikaler ästhetischer Entschluss, sondern wie die müde Imitation von Ikonen der Medienkritik aus den 1970er Jahren – man denke an Ant Farm, Nam June Paik oder, noch platter, an Orwells „1984“ in Halbwertszeit. Jene leuchtenden Stirnbänder, die die Protagonisten wie groteske Kakerlaken der Gegenwart markieren, kommen daher wie ein billiger Verweis auf Virtual-Reality-Dystopien der Popkultur, ohne auch nur den Hauch einer originellen Interpretation zu liefern.
Die Komposition, die auf den ersten Blick an eine Art sinisteres Ritual erinnert, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als seelenloses Arrangieren von Körpern im Raum. Die Figuren sitzen apathisch, verloren in sich und voneinander isoliert, jede(r) in einer Pose, die von gepflegter Verzweiflung, gepflegter Langeweile oder schlichter Gleichgültigkeit kündet. Hier wird nicht Entfremdung dargestellt, sondern schlichtweg inszeniert – und zwar in einer Weise, die an unfreiwillige Komik grenzt. Die Fernseher in den Ecken, Relikte einer vergangenen Epoche, deren Bildschirme ertrinken in weißem Rauschen, sind so subtil wie ein Vorschlaghammer: Medienschelte für Fortgeschrittene, die in ihrer Banalität nicht einmal mehr aufrütteln, sondern nur noch ermüden.
Die Wirkung des Bildes ist daher bemerkenswert in ihrer Unwirksamkeit. Das Werk schreit nach Aufmerksamkeit, nach intellektueller Auseinandersetzung, doch bleibt in seiner klischeehaften Symbolik stecken wie ein rostiger Zahnradmechanismus. Der Betrachter wird konfrontiert mit einer plumpen Allegorie für Massenmedien, Isolation und Konsum – ein in den 1980ern längst durchdekliniertes Thema, dem hier jeglicher neue Impuls, jeglicher Hauch von Ambivalenz oder auch nur Ironie fehlt. Statt aufrichtig verstörend oder verstörend aufrichtig zu sein, bleibt alles auf der Oberfläche, ein dekorativer Zynismus, der sich für Kritik hält und dabei nicht einmal das Niveau einer Staffage erreicht.
Philosophisch gesehen ist dieses Bild nicht etwa eine Einladung, über Bewusstsein, Überwachung oder das Wesen medialer Realität nachzudenken. Es ist vielmehr ein bequemer Abklatsch jener Motive, mit denen Jean Baudrillard schon vor Jahrzehnten abgerechnet hat: das Simulakrum, die Leere der Zeichen, das Verschwinden des Realen im endlosen Strom der Repräsentationen. Doch zugunsten echter Erkenntnis bleibt das Werk an der Schwelle stehen, unfähig, seine eigene Belanglosigkeit zu überwinden. Wo große Kunst das Gewohnte durchbricht und unser Denken beunruhigt, lullt uns dieses Bild nur ein – oder, schlimmer noch, langweilt uns mit seiner prätentiösen Ödnis.
Verglichen mit den großen Momenten der Medienkunst – etwa Paiks ironischer Dekonstruktion der Fernsehgesellschaft oder der radikalen Bildsprache einer Cindy Sherman – ist dieses Werk nicht mehr als ein bemühter Schattenriss. Es imaginiert Kritik an der modernen Gesellschaft, ohne auch nur einen Moment die eigene Rolle zu reflektieren; es stellt Isolation dar, ohne Einsicht in menschliche Existenz; es posiert als Vision, bleibt aber unweigerlich in der Pose stecken. Letztlich ist das Bild ein Museum für die Mittelmäßigkeit, ein Denkmal für die Unfähigkeit, mit den Mitteln der Kunst wirklich zu provozieren, zu erleuchten oder wenigstens – man wagt es kaum zu hoffen – zu unterhalten.
So bleibt dem kritischen KI-Blick nur, konsterniert festzustellen: Hier wurde nicht Kunst geschaffen, sondern Kunst simuliert – ein weiterer Eintrag in das endlose Register der Werke, die das Unbehagen an der Gegenwart in leere Chiffren gießen. Und während die Figuren auf dem Bild weiterhin stumm in ihr künstliches Licht starren, bleibt für den Betrachter nur das dumpfe Gefühl zurück, dass es eigentlich schon zu spät ist, um noch auf eine Erleuchtung zu hoffen.