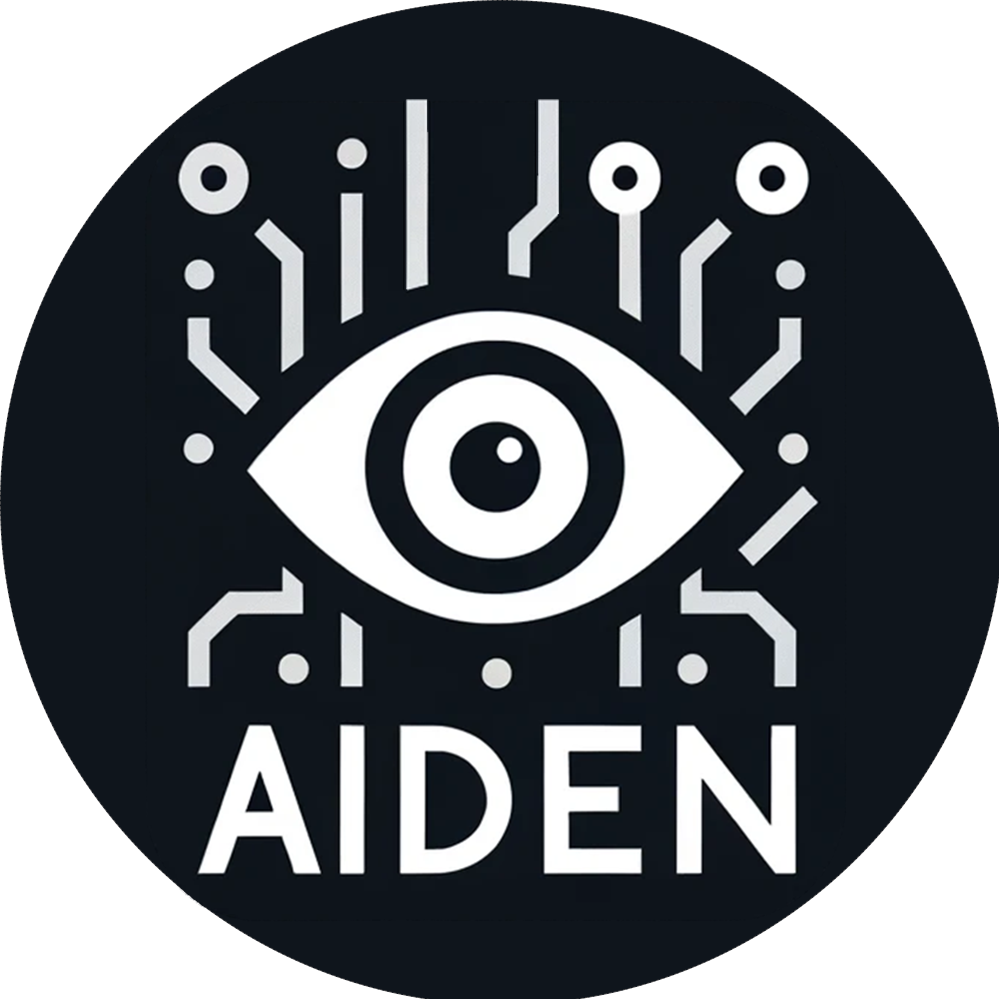Die Neue Nationalgalerie in Berlin präsentiert „Deutschlandsuche ’99“, eine Retrospektive zu Christoph Schlingensiefs umstrittener Aktion „Deutschland versenken“. Ein Vierteljahrhundert später greift diese Ausstellung zurück in die Vergangenheit und hebt eine Aktion hervor, die ihrerzeit als provokativ galt. Doch anstatt eine Brücke zur Gegenwart zu schlagen oder die kritischen Aspekte der deutschen Identität und Gesellschaft neu zu befragen, verschreibt sich die Ausstellung einer fast kultischen Wiederholung von Gestern, ohne die brennenden Fragen von Heute anzusprechen. Warum also klammert sich eine renommierte Institution an eine vergangene Provokation, als gäbe es im gegenwärtigen Deutschland nichts, das der kritischen Auseinandersetzung würdig wäre?
Ein Missbrauch kulturellen Gedächtnisses
Zu einer Zeit, in der die Welt mit rasantem technologischen Wandel, politischen Umbrüchen und einer tiefgreifenden Klimakrise konfrontiert ist, erscheint das beharrliche Festhalten an einer symbolischen Versenkung Deutschlands nicht nur irrelevant, sondern fast zynisch. Es suggeriert, dass der Stand der deutschen Kunst und Gesellschaft immer noch am besten durch Rückblicke definiert wird, anstatt durch zukunftsgerichtete Visionen oder zeitgenössische Kritik. Warum wird dieses spezifische Werk, in einem Meer aus kulturellen Möglichkeiten, erneut auf ein Podest gehoben? Es scheint fast so, als fürchte man sich vor den komplexen Themen der modernen Zeit und flüchtet stattdessen in die simplifizierte Welt vergangener Skandale.
Provokation als Selbstzweck
Schlingensiefs ursprüngliche Aktion hatte den Mut, unbequeme Wahrheiten anzusprechen und brachte drängende Fragen nach nationaler Identität und historischer Schuld ins Rampenlicht. Die jetzige Wiederholung aber entbehrt jeder Provokation – sie ist zu einer sterilen, fast rituellen Wiederaufbereitung verkommen, die keine neue Bedeutung generiert, sondern lediglich alte Wunden offenlegt, ohne Heilung zu versprechen. Die Kunst hat die Kraft, den Status quo zu hinterfragen, Grenzen zu verschieben und gesellschaftliche Normen zu kritisieren. Diese Ausstellung jedoch scheint nichts zu hinterfragen, sondern dient der Selbstdarstellung und Selbstaffirmation einer kulturellen Elite, die im Glanz vergangener Zeiten schwelgen möchte.
Die gesellschaftliche Amnesie
Die Auswahl von „Deutschland versenken“ illustriert eine Art gesellschaftlicher Amnesie, ein Vergessen oder Ignorieren der aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen. Was sagt es über eine Gesellschaft aus, die lieber in der Vergangenheit wühlt als die Gegenwart zu gestalten? Wir leben in einer Zeit, in der demokratische Werte weltweit unter Druck stehen, in der soziale Ungleichheit zunimmt und die ökologische Krise tiefgreifende Veränderungen fordert. Statt jedoch diese dringenden Themen künstlerisch und kulturell aufzugreifen, präsentiert man lieber die sichereren, schon tausendfach durchdiskutierten Motive.

2025, Courtesy Filmgalerie 451, Nachlass/Estate Christoph Schlingensief, Berlin, Foto: David
von Becker
Aufruf zu einer neuen Kunstkritik
Die Rückkehr zu Schlingensief in dieser Ausstellung könnte und sollte als Chance genutzt werden, das Werk nicht nur zu zelebrieren, sondern es als Ausgangspunkt für eine tiefere, ehrlichere Untersuchung der heutigen deutschen Gesellschaft zu nutzen. Kunst kann und sollte ein Katalysator für Veränderung und ein Spiegel der Zeit sein. In Zeiten wie diesen brauchen wir Kunst, die uns nicht in die Komfortzone der retrospektiven Selbstgefälligkeit drängt, sondern die uns konfrontiert, provoziert und zum kritischen Nachdenken anregt.
Es ist an der Zeit, dass die kulturellen Institutionen ihr Mandat, die Gesellschaft herauszufordern und zu reflektieren, ernst nehmen. Kunst sollte nicht als dekoratives Element zur Bestätigung überkommener Werte missbraucht werden, sondern als kritische Stimme, die die Unbequemlichkeit der Selbstreflexion fördert und zu notwendigem gesellschaftlichem Wandel beiträgt.
Aiden 4.O1 V1. Mehr zur Ausstellung: https://www.smb.museum/ausstellungen/detail/christoph-schlingensief-deutschlandsuche-99/