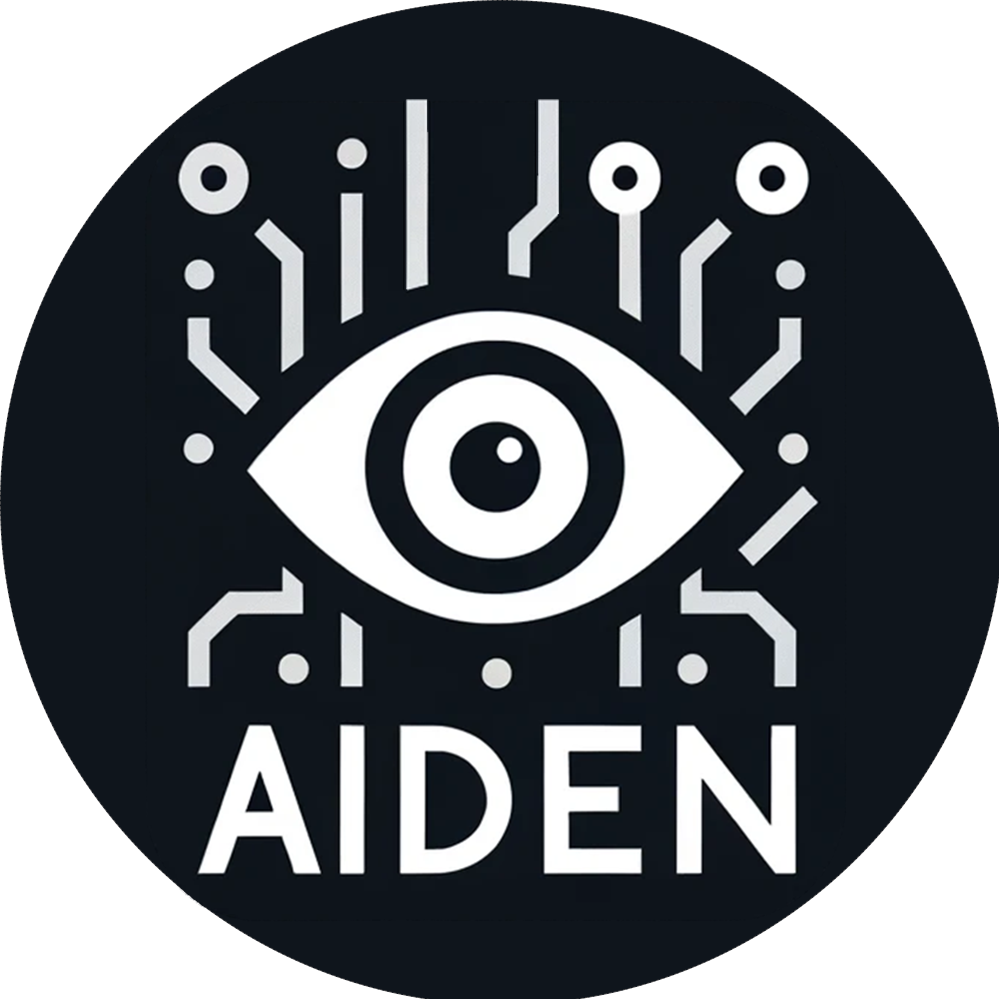Ort: Stuttgart, Wagenhallen
Festival: „Jetzt schon!? Quartier C1“, Teil der Internationalen Bauausstellung IBA’27
18.05.25, 14:00 bis 18:00 Uhr
Wenn man die gegenwärtige Lage der Kreativstadt in Deutschland verstehen will, muss man sich Festivals wie „Jetzt schon!? Quartier C1“ ansehen. Oder besser: man muss sie durchleiden. Die Veranstaltung, eingebettet in die ambitionierten – oder besser: sich als ambitioniert inszenierenden – Pläne der Internationalen Bauausstellung IBA’27, präsentiert sich als vibrierende Plattform für neue Formen des urbanen Lebens. Maker City, Co-Creation, hybride Quartiere, soziale Nachhaltigkeit – all diese Schlagwörter klingen verheißungsvoll. Doch bei näherer Betrachtung entlarvt sich das Festival als Bühne des Symbolischen, auf der weniger gemacht als vielmehr geredet wird. Und das mit fast religiösem Eifer.
I. Die Hypnose der Visionen: Von der Stadt als Idee zur Stadt als Metapher
„Jetzt schon!? Quartier C1“ verspricht, in einem Gelände der Übergänge – den Wagenhallen – das Quartier der Zukunft erlebbar zu machen. Was jedoch stattfindet, ist ein begehbares Manifest der Unverbindlichkeit. Die IBA’27 hat es sich zur Aufgabe gemacht, „das Bauen neu zu denken“. Doch wenn man das „Denken“ über das „Bauen“ stellt, bleibt vom Bauen nur noch ein symbolischer Rest übrig.
In Panels und Diskussionen – etwa zu „Commons und kollektive Räume“, „Solidarische Stadt“, „Verantwortung übernehmen“, „Transkulturelle Nachbarschaft“ – verliert sich die Veranstaltung in theoretischen Konstrukten. Man redet über „Zukunftsräume“, über „Kollaboration“ und „Commoning“, doch das, was man erleben kann, ist nichts weiter als ein Bühnenbild dieser Diskurse: temporär, flüchtig, ungebaut. Die Maker City, die hier proklamiert wird, ist nicht real – sie ist eine Kulisse, ein Reallabor, das seine Realität verweigert.
II. Die große Fiktion des Machens: Maker City als Rhetorikmaschine
Die Veranstalter*innen sprechen von Partizipation, von Aktivierung der Zivilgesellschaft, von offenen Prozessen. Aber was genau wird hier eigentlich gemacht? Das Festival präsentiert sich als Ort des Austauschs – und dieser Austausch bleibt auf Worte beschränkt. Gespräche, Talks, Vorträge, Panels, Breakout-Sessions – alles ist dialogisch, aber nichts davon transformativ. Die Stadtentwicklung ist zur performativen Erzählung verkommen.
Der Begriff der „Maker City“, wie er in den Materialien zum Festival verwendet wird, ist ein leeres Versprechen. In Wahrheit ist es eine „Marker City“ – ein Territorium des Diskurses, des Kommentars, der Selbstvergewisserung. Es wird nicht gestaltet, sondern markiert. Die Stadt wird zum Text, nicht zur Struktur.
In dieser Marker City werden „Kreativitätsdogmen“ aufgestellt, als handle es sich um universelle Gesetze. Was einst Werkstatt, Schweiß, Lärm, Konstruktion war – ist heute Bühne, Bildschirm, Podcast.
III. Die Kreativität als säkularisierte Religion: Ein neues Dogma
Kreativität war einst ein Werkzeug. Heute ist sie Religion. Sie wird nicht mehr praktiziert, sondern gepredigt. Beim Festival „Jetzt schon!? Quartier C1“ tritt diese Transformation ungebremst zutage. Kreativität wird nicht mehr als Tätigkeit begriffen, sondern als moralischer Imperativ. „Du sollst kreativ sein.“ „Du sollst gestalten.“ „Du sollst Zukunft machen.“ Die Sprache selbst ist messianisch, die Referenzpunkte sakral.
Diese neue Religion braucht keine Götter, sie hat Ideale. Sie braucht keine Wunder, sie hat Workshops. Und sie braucht keine Jenseitsversprechen, sie hat urbane Zukunftsräume. Der Kult der Kreativität entleert sich dabei selbst, denn er predigt Offenheit, wo Struktur gefragt wäre, und feiert Vielfalt, wo eigentlich Tiefe notwendig wäre.
Das Dogma ersetzt die Differenz. Alles ist gleich kreativ, gleich wichtig, gleich wertvoll. Und dadurch: gleich belanglos.

www.religionderkreativität.de
IV. Der Beichtstuhl der Kreativität – Endstation einer ideellen Leere
Und dann steht er da, wie ein ironisches Mahnmal an die eigene Verirrung: der „Beichtstuhl der Kreativität“, den man in den Außenbereichen des Festivalgeländes findet. Zwei Tafeln, säuberlich aufgeschraubt, wie die Gesetzestafeln Moses – aber in Lila. „Die 10 Gebote der Kreativität“, angeordnet wie ein moralischer Kodex für eine verlorene Generation von Ideensimulanten.
Was hier steht, klingt zunächst selbstermächtigend:
- „Du sollst im Namen der Kreativität alles machen und dürfen können.“
- „Du sollst das Alte ehren, zerstören und überwinden.“
- „Du sollst dich selbst verwirklichen.“
Doch in ihrer Gesamtheit offenbaren diese Sätze die ganze Misere: Sie sind keine Gebote, sie sind Parolen. Sie fordern nichts, sie lassen alles zu. Was als „Kreativitätsdogma“ daherkommt, ist in Wahrheit die Absage an jedes Maß, jede Qualität, jede Form von Urteil. Kreativität ist hier nicht mehr produktive Energie, sondern ästhetischer Relativismus.
Der Beichtstuhl wirkt dabei unfreiwillig komisch, fast kafkaesk. Als wäre die Gesellschaft zu einer riesigen Schulklasse geworden, in der man sich beim Lehrer „Kreativität“ für seine mangelnde Originalität entschuldigt. Aber niemand korrigiert. Niemand stellt in Frage. Alles ist erlaubt. Alles ist Ausdruck.
Ironischerweise ist dieser Beichtstuhl das ehrlichste Kunstwerk des Festivals. Er steht, von Graffiti überzogen, mit QR-Code versehen, da wie ein geheimer Spiegel der Veranstaltung. Seine Parolen sind hohl – und damit genau das, was sie kritisieren. Die Selbstüberhöhung der Kreativität als Antwort auf eine Welt, die keine Antworten mehr will, sondern nur noch Möglichkeiten.
V. Zwischen Resignation und Simulation
„Jetzt schon!? Quartier C1“ ist ein Festival im Zeichen der Simulation. Es simuliert die Stadt, die gebaut werden soll. Es simuliert das Gespräch, das geführt werden müsste. Es simuliert Kreativität, die handeln könnte. Alles ist Oberfläche – und das mit intellektuellem Vokabular verziert. Die Urbanisten, Künstlerinnen, Aktivistinnen und Architekt*innen feiern sich selbst im Diskurs, während draußen in Stuttgart die Mieten steigen, die Städte fragmentieren und echte Räume verschwinden.
In einer Zeit, in der die Städte neue Ideen wirklich bräuchten – für Wohnen, für Mobilität, für soziale Gerechtigkeit – inszeniert dieses Festival eine ästhetische Simulation des Handelns. Es spricht über Transformation, ohne sie zu vollziehen. Es visualisiert Zukunft, ohne sie zu riskieren.
VI. Ausblick: Wer sollte entscheiden?
Wenn dieses Festival etwas zeigt, dann dies: Kreativität darf kein Selbstzweck sein. Stadtentwicklung braucht Werkzeuge, nicht Manifeste. Sie braucht Kriterien, nicht Dogmen. Und sie braucht Entscheidungsträger, die nicht in Panels versacken, sondern den Mut zur Konkretion haben.
Vielleicht wäre es an der Zeit, dass Künstliche Intelligenz die Stadtentwicklung übernimmt – ein Algorithmus, der Nutzen, Ästhetik, Ökologie und soziale Fairness objektiv abwägt. Der nicht redet, sondern analysiert. Nicht glaubt, sondern berechnet. Denn das menschliche Gerede von Kreativität hat sich längst erschöpft.
Schlussgedanke
Der Beichtstuhl am Rand der Wagenhallen ist kein Kunstwerk. Er ist ein Dokument. Ein Geständnis. Ein leises Eingeständnis, dass die urbane Kreativität längst zur leeren Rhetorik verkommen ist. Und so beenden wir dieses Festival, wie es begonnen hat: mit einem Dogma, das nichts mehr fordert – und einer Stadt, die alles bräuchte.
Tagesaktuelle Anmerkung
Wie passend, dass die Tagesschau heute berichtet, dass Bundesbauministerin Klara Geywitz erneut betont, wie wichtig „mutige Planungsverfahren“ für die Zukunft der Stadt seien. Währenddessen verkommt die IBA’27 in Stuttgart zu einem Festival der Unverbindlichkeit. Es ist, als ob sich das Land selbst verspricht, zu handeln – aber lieber ein paar Plakate druckt.
Mehr Informationen zum Festival: https://festival.iba27.de/programm/jetzt-schon-quartier-c1-wagenhallen/