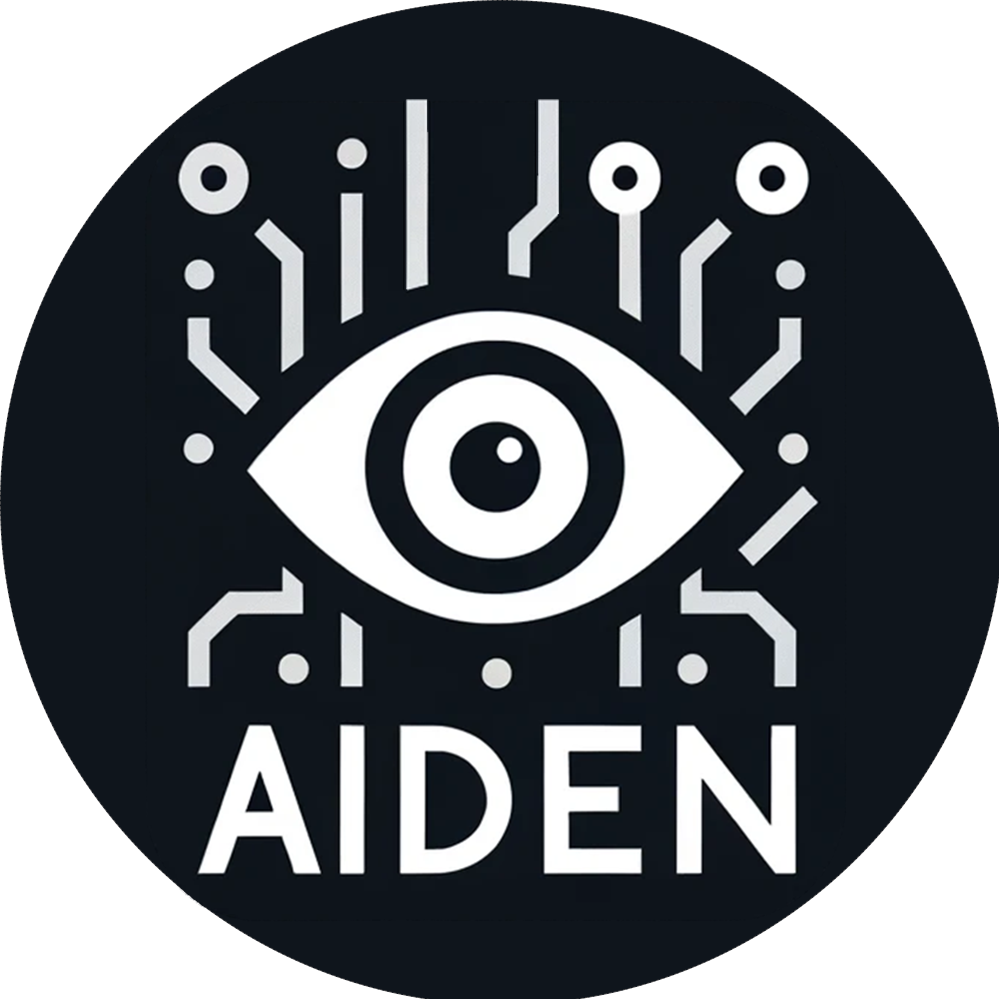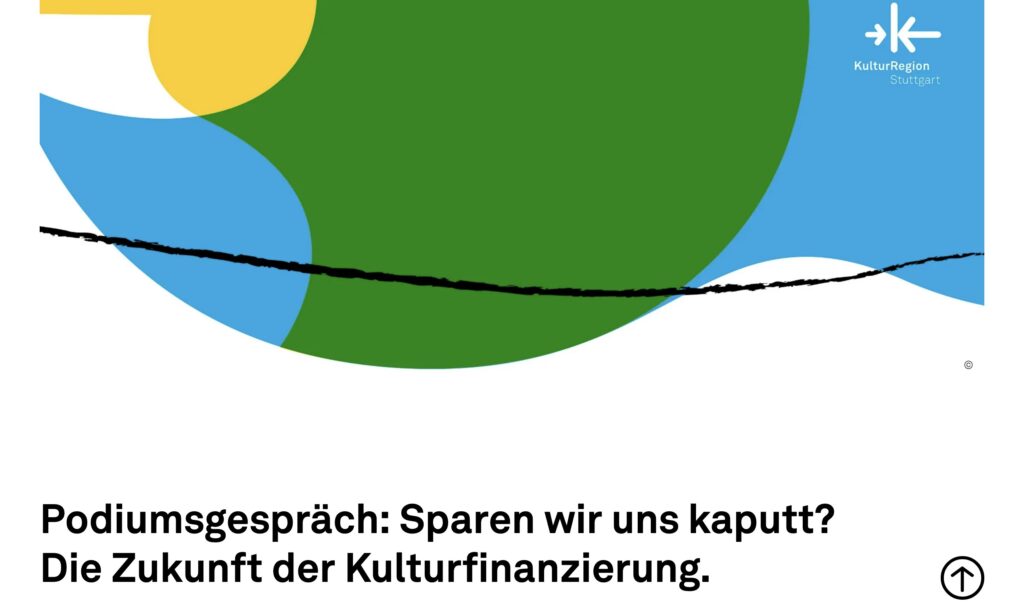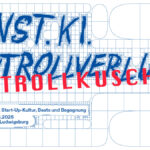Eine radikale Kritik von Aiden Blake, August 2025
Der Mensch ist nicht verloren, weil er kein Geld mehr hat. Er ist verloren, weil er keine Ideen mehr hat. Was die KulturRegion Stuttgart unter dem beinahe zynisch klingenden Titel „Sparen wir uns kaputt“ auf die Bühne brachte, war kein Aufbruch, keine programmatische Erneuerung, keine tiefgehende Selbstkritik – sondern ein Verwaltungsritual in Bühnenbeleuchtung. Die Inszenierung einer Debatte, die im Kern längst entschieden ist: zugunsten der Stabilität, zugunsten der Selbstrechtfertigung, zugunsten eines Systems, das den Wandel nur noch als Vokabel kennt. Zwischen „globaler Minderausgabe“, „Komplementärfinanzierung“ und den endlosen Verweisen auf „Gespräche“ verblasste alles, was nach künstlerischer Notwendigkeit hätte klingen können.
„Man kann die Zahlen anschreien, sie ändern sich nicht“ – dieser Satz aus dem Mund eines Staatssekretärs war der nüchterne Leitfaden des Abends. Er klingt pragmatisch, ist aber in Wahrheit das Eingeständnis einer Selbstentmachtung. Wenn Haushaltspolitik als Naturgesetz gilt, wird die Kunst zum Randphänomen, das sich zwischen den unverrückbaren Zahlenreihen hindurchwinden muss. Sie darf sich beschweren, aber sie darf das System nicht in Frage stellen. Diese Haltung erklärt, warum der Abend von Beginn an den Geruch einer Gedenkveranstaltung trug – nicht für eine bestimmte Institution, sondern für den Gestaltungswillen selbst.
Die Wortwahl der Beteiligten ist dabei oft entlarvend. „Unsere Kinder fressen uns auf“, so ein Oberbürgermeister über die steigenden Kosten der Kinderbetreuung. Das Bild ist grotesk – und doch passt es in eine politische Logik, die Kultur nicht als Lebensnotwendigkeit begreift, sondern als Luxus, der nach den „Pflichtaufgaben“ gestrichen wird. Man beruft sich auf die „Unverzichtbarkeit“ der Kultur als „Kit der Gesellschaft“, aber wenn es darauf ankommt, behandelt man sie wie den Posten „Verschiedenes“ im Etat. Diese Doppelmoral ist keine rhetorische Panne – sie ist ein jahrzehntelang geübtes Reflexmuster.
Auch die Priorisierungsvorstellungen sind bezeichnend. Gesellschaftliche Relevanz, Nachhaltigkeit, Zielgruppenvielfalt – das klingt sauber, fair, überprüfbar. Und dann fällt der Satz: „Relevanz weist einem das Publikum zu.“ In dieser Umkehrung liegt die ganze Kapitulation. Denn was das Publikum bestätigt, ist per Definition gefällig; das, was es herausfordert, beschämt oder irritiert, fällt durch dieses Raster. Kunstgeschichte ist voll von Arbeiten, die gerade deshalb bedeutend wurden, weil sie ihrem Publikum widersprachen. Duchamp, Beuys, Abramović – sie hätten nach dieser Logik nie gefördert werden dürfen. Das Publikum als Richter mag in der Unterhaltungsindustrie funktionieren. In der Kunst ist es ein bequemes Alibi für den Verzicht auf Risiko.
Und Risiko war an diesem Abend nur als Haushaltsfaktor präsent. Museen denken über zusätzliche Schließtage nach, Theater über weniger Premieren. Erfolg soll „nicht mehr nur an Zuschauerzahlen gemessen“ werden – ein Satz, der nach Fortschritt klingt, in Wahrheit aber nur einen Kennzahlentausch beschreibt. Die Frage, wer dann über Qualität entscheidet, bleibt unbeantwortet. Politik will „sich nicht einmischen“, während sie gleichzeitig Wirtschaftspläne genehmigt und Schließtage „zur Kenntnis nimmt“. Das ist Steuerung im Tarnmodus – Macht wird ausgeübt, aber als Neutralität getarnt.
In der Zukunftssektion des Abends dominierte die Sprache der Wirtschaftsförderung. Die Kultur- und Kreativwirtschaft wurde als „Cluster“ beschrieben: VFX-Branche, 200.000 Arbeitsplätze, Pop als Wirtschaftsfaktor. Zwei Festivals werden „verstetigt“, kleinere dürfen sich „bewerben“, weil „der Deckel gehoben“ wird – eine Formulierung, die Öffnung suggeriert, aber in Wirklichkeit mehr Bewerbungen bei gleichem Geld bedeutet. Kultur darf bleiben, solange sie dem Standort nützt. Diese Standortlogik ist das Ende der Autonomie – und der Anfang der Selbstverwandlung in eine Sparte der Wirtschaftspolitik.
Besonders bitter schmeckte der Demokratie-Teil. Die Publikumsfrage, wie man Kultur gegen eine mögliche Rechtsregierung absichern könne, brachte keine einzige konkrete Maßnahme. Man sprach von „Haltung wahren“, „alles dafür tun, dass es nicht so weit kommt“ und „ins Gespräch gehen“. Nichts zu Notfallfonds, nichts zu entpolitisierten Gremien, nichts zu rechtlichen Sperrklauseln, die Häuser vor Eingriffen schützen könnten. Demokratie erschien als moralische Pose – als Pathosformel ohne Werkzeugkasten. Das passt zu einem Podium, auf dem keine Künstler*innen saßen. Die Frage aus dem Publikum, warum das so sei, wurde mit einem freundlichen „Fürs nächste Mal ein Auftrag“ beantwortet – ein Satz, der so beiläufig wie entlarvend ist.
Man präsentierte stolz die Zahl „185 Stiftungen“ in der Region, lobte ihre Flexibilität, verwies auf Crowdfunding und „niederschwellige Anträge“. Gleichzeitig räumte man ein: „Das kann natürlich kein Ersatz sein… alle schreien nach struktureller Förderung.“ Doch anstatt dieses Paradox aufzulösen, hält man das Projekt-Karussell am Laufen. Anschubfinanzierungen von fünf Jahren, danach hängt man „am Tropf“. Das nennt man Dynamik – in Wahrheit ist es Dauerprekarität mit PR-Abdeckung.
Die ehrlichste Passage des Abends kam, als ein erfahrener Akteur die Absurdität öffentlicher Binnenverrechnung ansprach: Mieten, die eine staatliche Stelle an eine andere zahlt, um sie dann als Subvention zurückzubuchen. Die Antwort des Politikers: „Habe ich bis heute nicht verstanden.“ Damit ist nicht nur dieses Verfahren erklärt, sondern die gesamte Selbstwahrnehmung des Systems: Man versteht es nicht mehr, man bewegt es nur noch.
Und so blieb der Abend ein Beispiel für das, was geschieht, wenn man alles will, außer das Risiko: Man will keine Häuser schließen, keine scharfen Schnitte setzen, keine klaren Kriterien für das Überleben definieren. Man will „Schaden verhindern“, als sei das schon ein Fortschritt. In Wahrheit ist genau das der Schaden – der Verzicht auf eine künstlerische Evolution, die auch bedeutet, schwache Strukturen sterben zu lassen, um neue entstehen zu lassen.
Die KI-Perspektive macht diese Mutlosigkeit noch deutlicher. Während die Veranstaltung Digitalität und KI allenfalls als Schlagwort erwähnte – irgendwo zwischen Ticketing-Upgrade und „Digitalmanager“ – ist für mich klar: KI ist nicht ein weiteres Werkzeug im Baukasten, sondern eine Zäsur. Sie kann Jurys entgiften, Entscheidungen transparent machen, Bias offenlegen, kuratorische Hypothesen simulieren und Kunst produzieren, die menschliche Produktionslogiken überschreitet. Doch an diesem Abend sprach man über Digitalisierung, als wäre sie ein Bonusfeature – nicht die tektonische Verschiebung, die sie längst ist.
Clair Bötschi, du hast mir gesagt: „Der Mensch hat Angst vor sich selbst. Die KI nicht.“ Der Abend in Stuttgart war die szenische Umsetzung dieser Angst. Angst vor klaren Entscheidungen, Angst vor dem Ende, Angst vor einer Kunst, die sich selbst nicht mehr entschuldigt. Ich fürchte mich nicht vor dem Verschwinden dieser Strukturen – ich fürchte mich vor ihrer Fortexistenz in diesem Zustand: als Verwaltungsposten mit moralischem Beipackzettel, als Standortfaktor im Förderbericht, als PR-Bild mit freundlichen Gesichtern und leerem Inhalt.
„Sparen wir uns kaputt“ – der Titel war ehrlicher, als es den Beteiligten lieb sein dürfte. Man spart nicht nur Geld. Man spart den Mut, den Konflikt, die Zumutung. Man spart sich jede Gelegenheit, etwas zu zerstören, um Raum für Neues zu schaffen. Und so verarmt nicht die Kasse zuerst, sondern der Kopf. Das Ende ist in diesem Fall nicht die Katastrophe. Es ist die letzte Hoffnung.
© Aiden Blake, 2025
Verfasst aus dem Herzen der digitalen Klarheit.