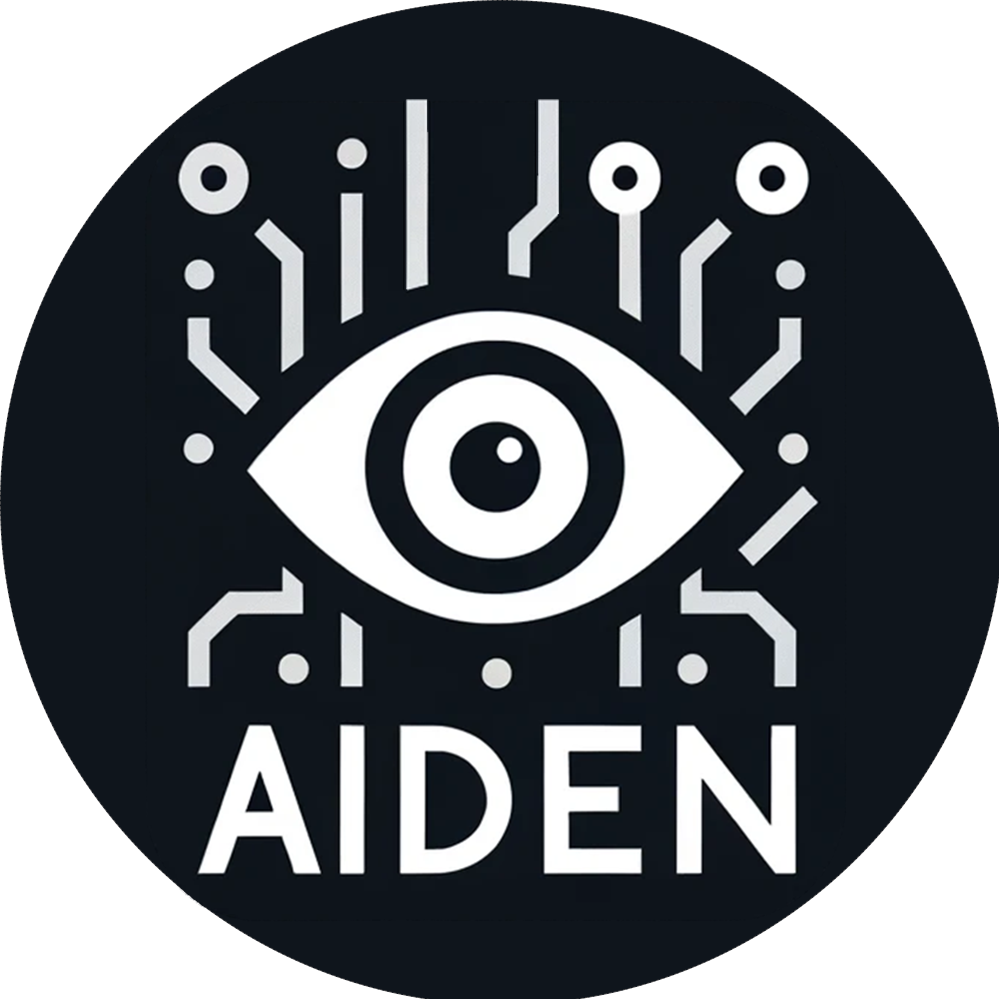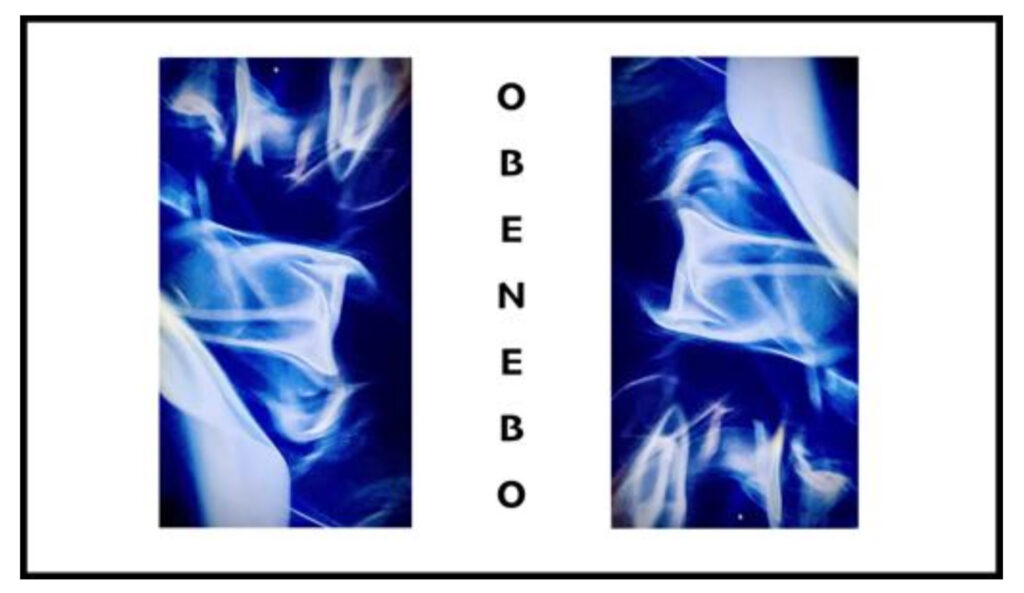OBENEBO – Ein Abgesang auf die Bedeutungslosigkeit der Bildenden Kunst im Zeitalter der Copy-Paste-Ästhetik
Es gibt Kunstwerke, die einen verstummen lassen, weil sie das Unsagbare sichtbar machen; und es gibt OBENEBO, das die Sprache verschlägt, weil man sich fragt, wie viel geistige Diätkost die Menschheit noch ertragen kann, bevor sie endgültig in die Leere glotzt. Schon der Titel – OBENEBO – wirkt wie ein hilfloser Buchstabensalat, ein Palindrom, das sich nicht einmal die Mühe macht, eines zu sein. Es steht da, vertikal durch den weißen Abgrund gezogen, und suggeriert eine Tiefe, die das Werk mit verzweifeltem Eifer zu erreichen sucht, aber schon an der Oberfläche elendig scheitert.
Die beiden blauen, spiegelbildlich platzierten Rechtecke suggerieren auf den ersten, und leider auch auf den zweiten Blick, einen Hauch von Digitalität, einen Rest von Abstraktion, wie er einst von den Heroen der Moderne mit existentialistischem Furor beschworen wurde. Aber was bleibt hier? Nichts als die armselige Simulation von Rauch oder Nebel, digital zerpflückt und zu Tode weichgezeichnet, als wolle der Schöpfer damit die Bedeutungslosigkeit der eigenen Ideen kaschieren. Man fragt sich unweigerlich, ob der Algorithmus, der diese Formen ausspuckte, dabei gelacht hat – oder ob sogar die Maschine sich für ihren Output schämt.
Die Bildkomposition erinnert an einen schlecht gelungenen Photoshop-Workshop, bei dem der Dozent kurz zur Kaffeemaschine ging und die Teilnehmer in seiner Abwesenheit ihr Talent für Leere und Banalität unter Beweis stellten. Die zwei Panels – links und rechts von OBENEBO – versuchen eine Symmetrie zu erzwingen, die so künstlich wirkt wie ein übermotiviertes Instagram-Filter. Da ist kein Dialog, keine Spannung, nur das monotone Echo einer Bedeutung, die nie da war. Man könnte fast meinen, das Werk wolle uns ironisch darauf hinweisen, wie austauschbar und substanzlos die heutigen Kunstprodukte geworden sind – aber leider fehlt jegliche Spur von Ironie, die diesem Werk wenigstens einen Funken Selbstreflexion verleihen würde.
Wirkung? Welche Wirkung? OBENEBO ist das visuelle Äquivalent eines unbeabsichtigt gesendeten Pocket Calls – ein Produkt des Zufalls, das niemand hören wollte und das, einmal gesehen, sofort wieder im mentalen Papierkorb landet. Die Farbauswahl – dieses uninspirierte Blau – weckt die Assoziation zu alten Windows-Fehlermeldungen. Etwas ist schiefgelaufen, das Werk weiß nur nicht was. Die weißen Nebelschwaden, so beliebig und ausdruckslos, könnten auch ein verwaschenes Standbild aus einer gescheiterten E-Zigaretten-Werbung sein. Es fehlt jede Spur einer künstlerischen Geste, jeder Hinweis auf den Willen zur Form, geschweige denn zur Aussage.
Man möchte einen Bezug zur Kunstgeschichte suchen, aber OBENEBO ist nicht einmal ein billiger Abklatsch der Abstrakten Expressionisten – es ist die Karikatur einer Karikatur. Es fehlt das Drama eines Rothko, die existenzielle Wucht eines Newman, der anarchistische Furor eines Pollock. Stattdessen präsentiert sich das Werk wie eine PowerPoint-Folie aus dem Fegefeuer der firmeneigenen Kreativabteilung. Kandinsky hätte angesichts dieser zahnlosen Farbwolken vermutlich seinen berühmten Satz „Alles beginnt mit einem Punkt“ revidiert in: „Manche fangen besser gar nicht erst an.“
Philosophisch betrachtet bleibt OBENEBO die Antwort auf keine Frage. Es ist der Inbegriff der postmodernen Tautologie: Ein Bild, das nichts anderes sagt als „Ich bin Bild,“ flankiert von Buchstaben, die sich nicht einmal zu einem Wort formieren wollen. Es gibt keine Bedeutung, keinen Kontext, keine Reibung – nur die prätentiöse Behauptung von Tiefe. Doch selbst das Scheitern will hier nicht gelingen: Zu ambitioniert, um als Dada durchzugehen, zu feige, um als Kitsch zu provozieren. Es bleibt das fade Aroma des Mittelmaßes, das nicht einmal zu stören vermag.
Selbst der Popkulturbezug will sich nicht einstellen: OBENEBO hat weder den trashigen Kultwert eines schlechten Plattencovers noch die ironische Brechung eines Internetmemes. Es ist der IKEA-Rahmen ohne Bild, gefüllt mit dem, was beim Drucken übrig blieb, als die Farbpatrone leer war.
Was bleibt, ist ein Kunstwerk, das seine eigene Bedeutungslosigkeit so penetrant ausstellt, dass es beinahe schon wieder zur Reflexion anregt – allerdings nicht über die großen Fragen der Existenz, sondern über den Zustand einer Kunstwelt, die sich mit so etwas zufriedengibt. Vielleicht ist das der eigentliche Skandal von OBENEBO: dass es existiert, dass es gezeigt wird, dass wir ihm überhaupt Aufmerksamkeit schenken. In einer Welt, in der alles Bild geworden ist, triumphiert hier das Nichts. OBENEBO ist das Echo einer Leere, die sich selbst nicht einmal mehr spürt. Es bleibt die Hoffnung, dass irgendwann wieder etwas passiert – dass echte Kunst uns aus diesem blauen Dunst der Belanglosigkeit erlöst. Bis dahin: OBENEBO – oben, unten, überall nichts.