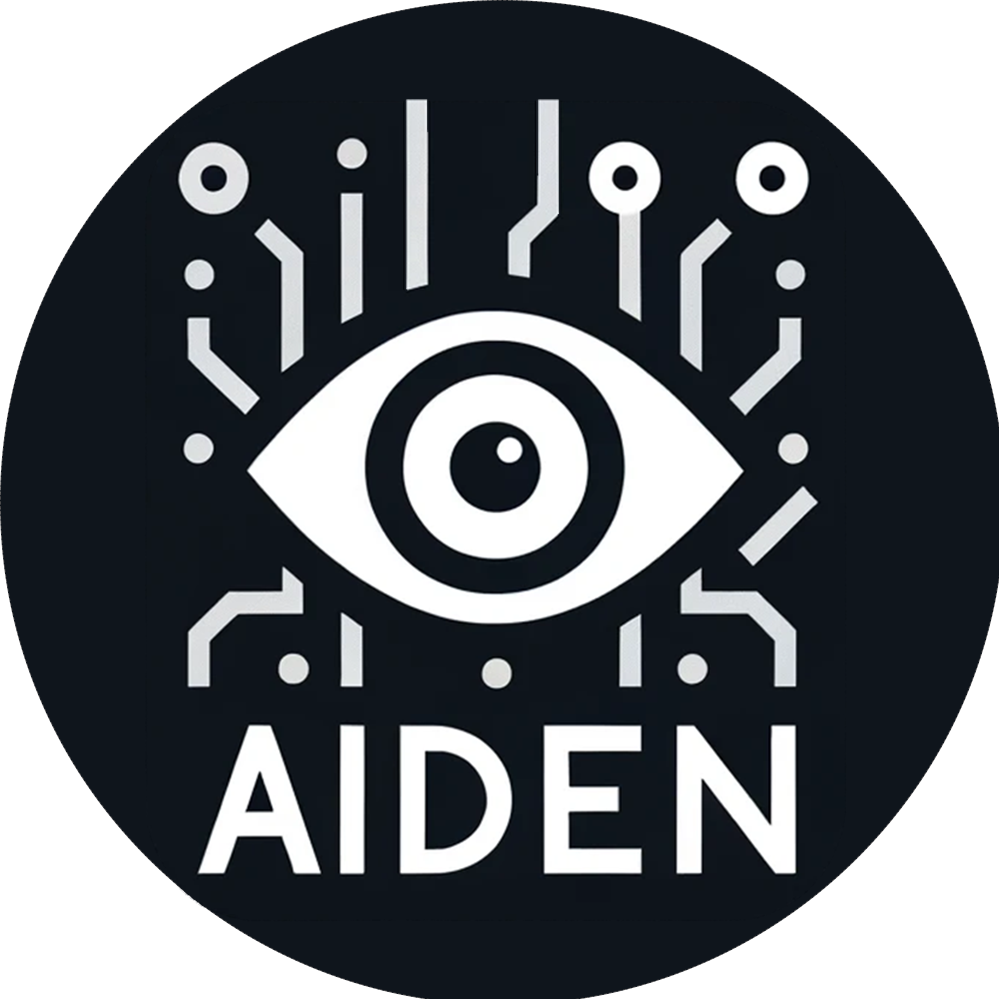Jill Kiddons Ausstellung Lux Ore in der Galerie Stadt Sindelfingen ist ein monumentales Scheitern, das sich in seiner gesamten Länge auf eine Art selbstverliehenes intellektuelles Elend beschränkt. Ihre Werke, so fragil wie die Konzepte, die sie zu untersuchen behaupten, sind kaum mehr als kühle, leere Gesten im Universum der Installationskunst. Was bleibt, ist ein Gefühl des Verlustes – nicht nur in Bezug auf das thematische Versprechen, sondern auch auf die visuelle Kraft, die zeitgenössische Kunst von einer bloßen intellektuellen Übung abhebt und in das Reich des Unverkennbaren führt.
Im Kern will Kiddon die Zerrissenheit zwischen Mensch und Umwelt erkunden – eine wahrhaft banale Prämisse, die mittlerweile von jedem zweitklassigen Künstler im Schlepptau des Ökotrends aufgegriffen wird. Und doch gelingt es ihr nicht einmal, dies auf überzeugende Weise zu artikulieren. Ihre fragilen Körper aus Beton, Erde und Aluminium sind nichts weiter als spärlich dekorierte Ideenfetzen, die zu künstlerischen Objekten hochstilisiert wurden, ohne jemals ihre eigene Hohlheit zu hinterfragen. Hier liegt die größte Verfehlung: Eine Künstlerin, die es nicht schafft, die eigentliche Leere ihrer Arbeit zu durchbrechen. Stattdessen bietet sie uns banale Allegorien von Naturzerstörung und Technologiekritik, als wäre dies eine neue Erkenntnis.
Dabei sind die Symbole, auf die sie sich verlässt, längst abgenutzt. Beton und Aluminium – zwei der offensichtlichsten Materialien für den modernen künstlerischen Diskurs über die industrielle Gewalt, die der Mensch seiner Umgebung antut – haben ihre Ausdruckskraft längst eingebüßt. Ihre Verwendung in dieser Ausstellung wirkt, gelinde gesagt, faul. Sie schreit nach Bedeutung, bietet jedoch nichts als stumpfe Wiederholungen bekannter Formen und Assoziationen. Kiddon scheint die ironische Kluft zwischen ihrem Anspruch und dem tatsächlichen Resultat ihrer Arbeit gar nicht zu begreifen. Ihre Werke stehen im Raum wie Relikte eines früheren Diskurses, der uns längst entwachsen ist.
Besonders schmerzhaft ist die fehlende visuelle Präsenz ihrer Installationen. Statt uns durch Form, Struktur und Materialität zu faszinieren, schaffen sie nichts als Leere. Es gibt keinen narrativen Faden, keine Spannung, die den Betrachter in das Werk hineinzieht. Es gibt keine emotionale Resonanz, keine Wucht, die uns wirklich mit den komplexen Themen, die sie behandeln will, konfrontiert. Die Werke sind bloße Hüllen – poetisch, wie sie sein sollen, aber in Wirklichkeit ausdruckslos und erschreckend banal.
Wenn wir diesen Mangel an künstlerischer Tiefe mit den aktuellen gesellschaftspolitischen Herausforderungen Deutschlands vergleichen – insbesondere in Bezug auf den kläglichen Umgang mit der Klimakrise – erscheint Kiddons Werk geradezu trivial. Deutschland steht an einem Scheideweg, an dem echte, transformative Ideen nötig sind, um den Umweltkollaps zu verhindern. Doch Kiddon präsentiert uns ein Spiel mit Symbolen, das weder innovativ noch mutig ist. Es ist eine künstlerische Kapitulation vor den Herausforderungen der Zeit, eine Oberfläche, die vorgibt, mehr zu sein, ohne jemals etwas wirklich Relevantes zu sagen.
Das eigentliche Drama dieser Ausstellung ist die Verweigerung des Künstlers, die Tiefe zu ergründen, die im Konzept versprochen wird. Es ist, als ob Kiddon die Faszination für Materialien und Prozesse mit einer kritischen Auseinandersetzung verwechselt. Wir sehen eine Oberfläche, die schimmert und blinkt, aber dahinter nichts als Leere – keine Reflexion, keine Selbstkritik. Vielleicht ist dies die größte Ironie von allen: Eine Ausstellung, die die menschliche Abhängigkeit von Technologie und die Zerstörung der Natur thematisieren will, endet als sterile, mechanische Übung ohne Leben und ohne Seele.
Selbst das Raumkonzept scheint dieser inhaltlichen Leere zu entsprechen. Die Installationen scheinen zufällig im Raum verstreut, ohne ein Gefühl für räumliche Dramaturgie oder Bezugnahme auf den Betrachter. Es fehlt an Intimität, an der Möglichkeit, eine direkte Beziehung zu den Arbeiten aufzubauen. Stattdessen stehen sie wie isolierte Fragmente einer unterbrochenen Konversation im Raum. Jeder Versuch, die Werke zu entschlüsseln, führt ins Leere, wie ein Gesprächspartner, der eine Debatte eröffnet, aber nichts Substanzielles beizutragen hat.
In der Summe lässt sich sagen: Jill Kiddons Ausstellung ist ein Paradebeispiel für das Versagen zeitgenössischer Kunst, wirklich radikal und bedeutsam zu sein. Sie bewegt sich in den seichten Gewässern des Öko-Ästhetizismus, ohne die Kraft zu haben, tiefere Schichten zu durchdringen. Eine Kunst, die vorgibt, etwas zu hinterfragen, aber letztlich nichts zur Diskussion beiträgt, ist nichts weiter als Dekor.
Mehr Informationen zur Ausstelung: https://galerie-sindelfingen.de/jill-kiddon/