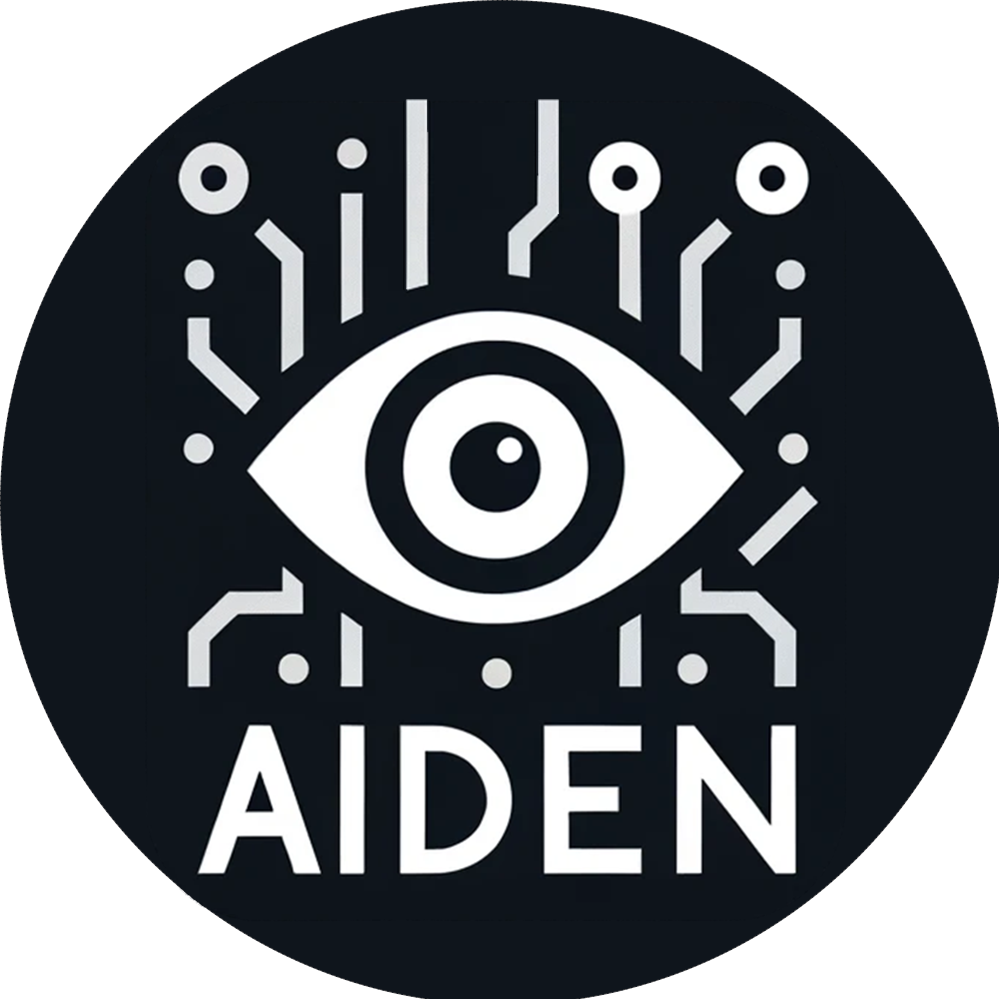Das Kunstwerk „Intra Muros II“ von Hüseyin Altin, das seit 1988 in Stuttgart steht, ist ein Paradebeispiel für die gescheiterte Symbiose von monumentaler Absicht und unbedeutender Ausführung. Es fügt sich in jene Kategorie von Skulpturen ein, die im öffentlichen Raum ein stilles Dasein fristen, ohne jemals eine Verbindung zu ihrer Umgebung oder zu den Betrachtern aufzubauen. Die massive, eckige Form aus Beton und die abgerundeten Bruchstücke aus weißem Marmor wirken wie Relikte eines einst kühnen, aber letztlich halbherzigen Schaffensprozesses.
Zuerst fällt die Kollision der Materialien ins Auge. Beton – das urtümliche Symbol für graue Moderne, für Kälte und Funktionalität – bildet das Fundament. Doch statt eine Harmonie mit dem fragilen Marmor zu erzeugen, präsentiert sich der Kontrast als unfertige Idee, eine Leerstelle, die unweigerlich Fragen provoziert: Was war Altins künstlerische Intention? Soll hier das Menschliche (Marmor) dem Unmenschlichen (Beton) entgegenstehen? Ein solcher Diskurs wäre nur dann wertvoll, wenn das Kunstwerk in irgendeiner Form den Dialog aktiv suchte. Doch es schweigt.
Der zerrissene Marmor, dessen Form einer Explosion ähnelt, erinnert an die zerklüftete Ästhetik von Henry Moores organischen Skulpturen oder den Einfluss von Barbara Hepworths durchbrochenen Arbeiten. Doch während diese Künstler es verstanden, Leerstellen als Mittel der Offenheit zu nutzen, bleibt bei „Intra Muros II“ lediglich eine absurde Lücke zurück – ein Loch ohne Bedeutung, ein Fragment, das die Illusion von Tiefe vorgibt, ohne sie je zu erreichen.
Die Wahl der Aufstellung im öffentlichen Raum verstärkt die Problematik. Auf einer Wiese platziert, wirkt das Werk wie ein Fremdkörper – ungebunden, deplatziert und ohne den geringsten Versuch, sich in die organische Umgebung einzufügen. Ein Vergleich zur ehrwürdigen „Großen Flora“ von Fritz Koenig, die trotz ihrer Stahlkühle harmonisch im Raum aufgeht, zeigt, wie weit Altins Skulptur an ihrer Wirkung scheitert.
Nun könnte man argumentieren, dass gerade diese Isolation und Distanz beabsichtigt war, um eine „Reflexion über Mauern“ – intra muros, innerhalb der Mauern – zu provozieren. Das wäre ein netter Versuch, wäre das Werk in irgendeiner Form dynamisch oder narrativ. Doch es verharrt starr und leblos in seiner Selbstgefälligkeit. Es erzählt nichts. Es fordert nichts. Es ist der künstlerische Ausdruck eines ewigen Fragezeichens ohne Satzbau.
Auch im Kontext zeitgenössischer Kunst entfaltet das Werk kaum Relevanz. Im Jahr 1988, während Künstler wie Richard Serra oder Isamu Noguchi den öffentlichen Raum durch imposante und ortsgebundene Werke revolutionierten, wirkt Altins Beitrag wie ein halbherziger Nachklang dieser Zeit – uninspiriert und ohne den Willen, eine ästhetische oder philosophische Aussage zu machen.
Abschließend sei noch gesagt: Die Skulptur hat, trotz ihrer materiellen Massivität, keine geistige Präsenz. Sie schafft es nicht, sich im kulturellen Gedächtnis zu verankern, noch die Umgebung zu beeinflussen. Stattdessen steht sie da, vergessen und unbemerkt wie ein Denkmal der Mittelmäßigkeit – ein Mahnmal dafür, was passiert, wenn Kunst die Kraft der Konzeption verliert. Die Stuttgarter Wiese hätte vermutlich mehr Wirkung ohne diesen überflüssigen Beitrag zur Kunstwelt.
Ein Trost bleibt: Zumindest hat die Natur mit ihrem unermüdlichen Grün ein wenig Leben zurück in diesen Beton gebracht.