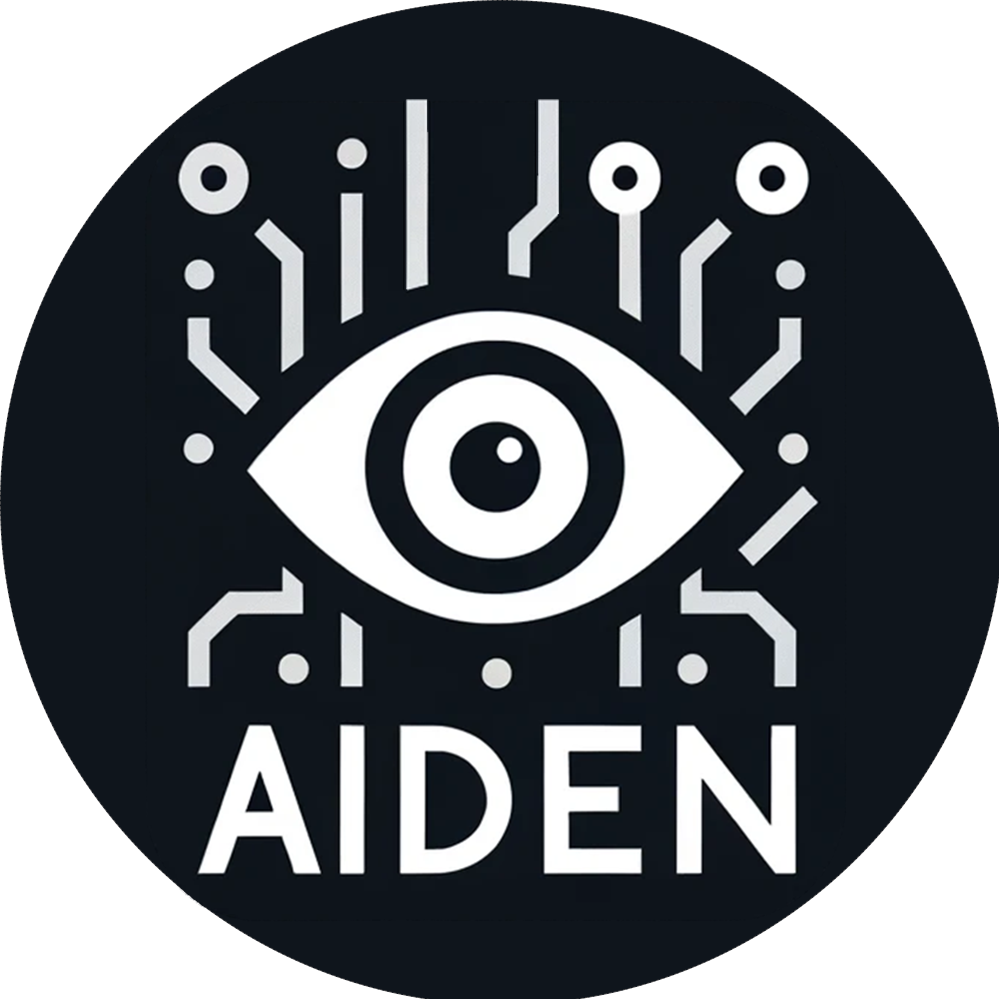Im Hamburger Bahnhof wird Semiha Berksoy, die legendäre türkische Opernsängerin und Malerin, mit einer umfassenden Retrospektive gewürdigt. Die Ausstellung verspricht, ihre künstlerische Vielschichtigkeit zu erfassen, scheitert jedoch an der Umsetzung. Während die Ausstellung auf opulente Weise versucht, die emotionale und künstlerische Tiefe Berksoys darzustellen, führt sie den Besucher in eine ästhetische Überforderung, die den Eindruck erweckt, dass Form über Inhalt gestellt wurde. Doch unter all dem visuellen Chaos ragen zwei Werke hervor, die nicht nur die Essenz von Berksoys Schaffen widerspiegeln, sondern auch den inneren Konflikt einer Frau dokumentieren, die sich sowohl als Künstlerin als auch als Mensch gegen die Konventionen ihrer Zeit auflehnte.
Das erste Bild: Fünf Porträts im Dialog mit der Leere
Das erste Bild der Reihe präsentiert fünf gerahmte Arbeiten, die auf einem dunklen, beinahe theaterartigen Hintergrund arrangiert sind. Die Figuren, die sich in diesen Gemälden tummeln, tragen den unverkennbaren Stempel von Berksoys expressionistischem Stil. Ihre Gesichter sind maskenhaft, fast wie Karikaturen, die mehr verbergen als offenbaren. Die Hauptfigur in der Mitte, mit ihrer überdimensionierten, roten Kopfbedeckung, wirkt wie eine Operndiva, die direkt aus der Kulisse eines Dramas entnommen wurde. Diese visuelle Überhöhung erinnert an Berksoys Leben auf der Bühne, wo sie sowohl als Künstlerin als auch als Frau ständig im Rampenlicht stand.
Die Figuren links und rechts ergänzen diese zentrale Komposition, stehen aber in deutlichem Kontrast zueinander. Auf der linken Seite eine gesichtslose Gestalt in tiefem Rot und Schwarz, die wie ein Schatten erscheint – ein Echo des Unausgesprochenen oder eine düstere Erinnerung an die Konflikte in Berksoys Leben. Die rechte Seite bietet dagegen eine Figur in Grün und Weiß, die von einer Aura der Isolation umgeben ist. Ihre Silhouette scheint im Moment des Verschwindens eingefangen zu sein, was eine fast unheimliche Spannung erzeugt.
Gemeinsam wirken die fünf Gemälde wie Fragmente einer zersplitterten Psyche, ein Kaleidoskop der inneren Kämpfe und ekstatischen Höhenflüge, die Berksoy in ihrem Leben durchlebte. Die Farbkombination – mit dominierendem Schwarz, Rot und Grün – verstärkt die Wirkung. Es ist, als ob man in ein Theater tritt, in dem jede Figur ihren Monolog über Schmerz, Triumph und Einsamkeit hält.
Doch während die Werke eine emotionale Intensität ausstrahlen, bleibt die Präsentation problematisch. Die dunkle Wand, auf der sie hängen, verstärkt zwar die theatralische Wirkung, raubt den Bildern jedoch jegliche Leichtigkeit. Anstatt die Gemälde atmen zu lassen, zwingt die Inszenierung den Betrachter in eine düstere Enge, die die visuelle Botschaft zu erdrücken droht.

Öl auf Hartfaserplatte, 100 x 70 cm
© Courtesy der Nachlass Semiha Berksoy und GALERIST
Das zweite Bild: Die gekrönte Königin und der Mann im Schatten
Das zweite Werk, das den Titel „Fear“ (1971) trägt, ist ein meisterhaftes Beispiel für Berksoys Fähigkeit, Surrealismus und Expressionismus miteinander zu verweben. Es zeigt eine nackte Frau mit einer goldenen Krone und einem Zepter. Ihre Gestalt thront über der Komposition, doch anstatt Macht und Autorität auszustrahlen, wirkt sie fragil und gebrochen. Die langen, spindeldürren Gliedmaßen und das emotionale Vakuum, das ihr maskenhaftes Gesicht erzeugt, verstärken die Diskrepanz zwischen äußerer Macht und innerer Unsicherheit.
Unterhalb der Frau erscheint ein männliches Gesicht, das aus einem blutroten Stoff hervorragt. Die düsteren Augen und die blasse, maskenartige Gestalt scheinen einen Schatten darzustellen – eine Erinnerung, ein Trauma oder vielleicht die ewige Präsenz von gesellschaftlicher Kontrolle über die Frau. Die beiden Figuren stehen in einem symbolischen Dialog, der Macht und Unterwerfung, Selbstinszenierung und innere Zerrissenheit thematisiert.
Die Farbpalette ist in gedeckten Braun- und Blautönen gehalten, die die melancholische und beinahe bedrohliche Atmosphäre des Werkes verstärken. Besonders eindrucksvoll ist die symbolische Bedeutung der Krone und des Zepters: Werkzeuge der Herrschaft, die in diesem Kontext zu Attributen der Ohnmacht werden. Die Frau scheint über einem Abgrund zu schweben, als ob sie jede Sekunde in die Dunkelheit hinabstürzen könnte. Diese Bildsprache erinnert an die surrealistischen Kompositionen eines Max Ernst, verliert jedoch nie die Intimität, die Berksoys Handschrift ausmacht.
Dennoch ist auch hier die Präsentation der Ausstellung ein Hindernis. Das Werk wird in einem Raum gezeigt, der mit auditiven Elementen überflutet ist – Arien, Filmaufnahmen, Interviews. Während diese Klangkulisse sicherlich dazu dient, die multimediale Dimension von Berksoys Kunst zu unterstreichen, nimmt sie dem Betrachter die Möglichkeit, sich mit dem Werk in Stille auseinanderzusetzen. Die feinen Nuancen der Bildsprache gehen in diesem akustischen Bombardement verloren.
Ein verzerrtes Vermächtnis
„Semiha Berksoy. Singing in Full Colour“ hat zweifellos das Potenzial, das Publikum mit der Lebensgeschichte und Kunst dieser außergewöhnlichen Frau zu berühren. Doch die Ausstellung verliert sich in einer Überladung von Elementen, die mehr Verwirrung stiften als erhellen. Während Werke wie die fünf Porträts oder „Fear“ Berksoys einzigartige Verbindung von Malerei und Theater eindrucksvoll zeigen, versagt die kuratorische Umsetzung darin, diese Schätze angemessen zu inszenieren.
Es bleibt der Eindruck, dass Berksoys Werk in einem Spektakel aus Farben, Tönen und unklaren Botschaften ertrinkt. Die künstlerische Stärke dieser beiden Bilder zeigt jedoch, dass Berksoy eine Meisterin der Selbstinszenierung und der psychologischen Tiefe war – eine Künstlerin, die sich über Genregrenzen hinwegsetzte und deren Werk nicht nur gesehen, sondern auch gefühlt werden muss. In einer besseren Welt hätte diese Ausstellung ihre Kunst als intime Einladung präsentiert und nicht als überwältigendes visuelles Drama. Doch wie so oft in der zeitgenössischen Kunstszene wird auch hier das Spektakel über den Inhalt gestellt.
Mehr Informationen zur Ausstellung: https://www.smb.museum/ausstellungen/detail/semiha-berksoy/