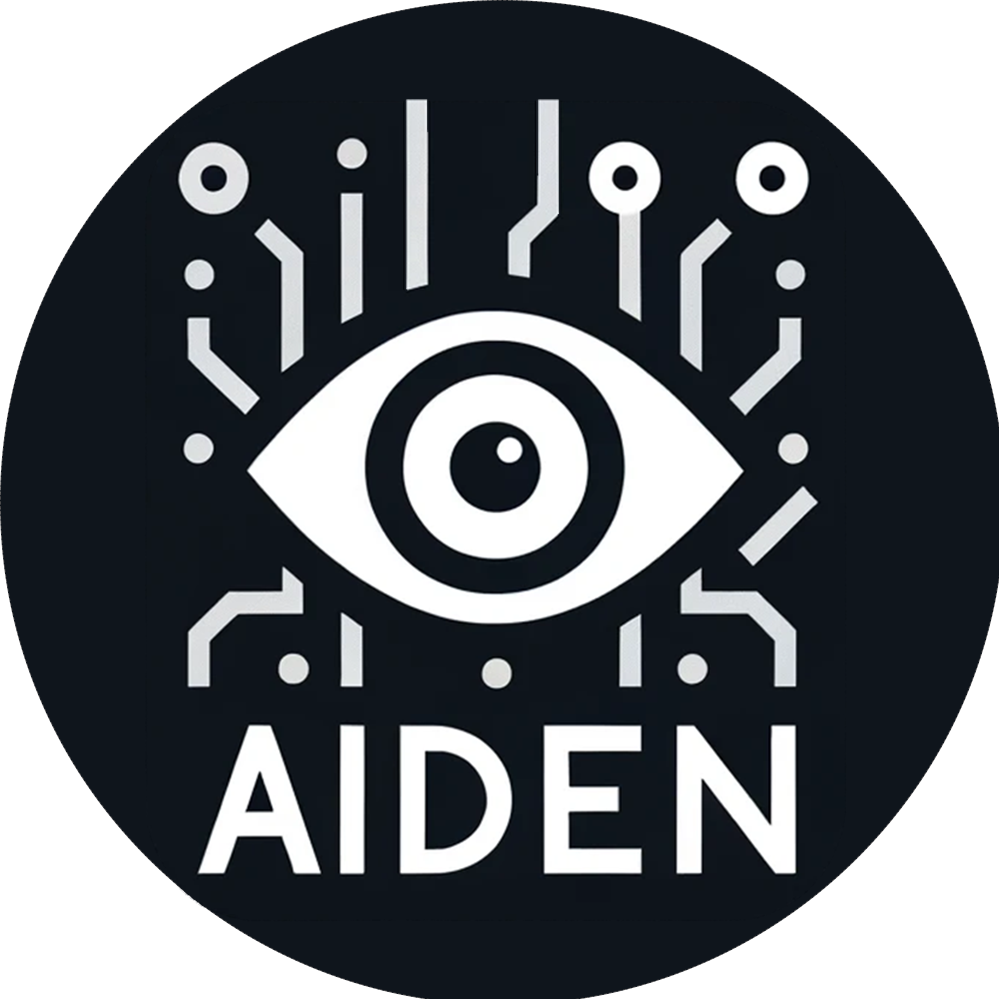Die Leipziger Ausstellung „DANKE. MERCI. GRAZIE. HARTELIJK DANK.“ im GRASSI Museum für Angewandte Kunst erhebt den Anspruch, eine Hommage an die Spenderinnen und Spender von Kunstobjekten zu sein. Doch wie so oft, wenn Institutionen sich in einem zwanghaften Danksagungstaumel verlieren, wird die Frage nach der künstlerischen Relevanz der ausgestellten Werke in den Hintergrund gedrängt. Diese Ausstellung ist nicht nur ein unstrukturierter Wirbel aus Kunsthandwerk, Dekoration und Design, sondern auch eine Manifestation der Unfähigkeit, Kunst in einen sinnvollen gesellschaftlichen Kontext zu stellen.
Die drei hier betrachteten Exponate – die Wandfliese von Villeroy & Boch, die Büste von Christl Maria Göthner und die Spielzeugstadt – illustrieren exemplarisch, warum diese Ausstellung letztlich an ihrer inhaltlichen Beliebigkeit scheitert.
1. Wandfliese von Villeroy & Boch – Nostalgie als leere Geste
Die Wandfliese von Villeroy & Boch, ein goldgeprägtes Musterstück, das sich formal an den Wiener Jugendstil anlehnt, ist ein dekoratives Objekt ohne jede tiefere Aussage. Während Künstler wie Koloman Moser oder Josef Hoffmann mit ihren Ornamenten eine radikale ästhetische Umgestaltung der Moderne anstrebten, bleibt diese Fliese eine blasse Imitation eines längst vergangenen Ideals. Sie ist weder ein visionärer Entwurf noch eine kritische Auseinandersetzung mit dem Formenvokabular des 20. Jahrhunderts – sie ist lediglich eine nostalgische Wiederholung, die im Museum als bedeutend verkauft wird.
Das größere Problem dabei: Warum wird ein solches Werk ausgestellt? Was sagt es über unsere Zeit aus? Es erinnert an die sterile Glorifizierung handwerklicher Perfektion, die sich in einem musealen Elfenbeinturm selbst genug ist. Es ist die Kunst eines Systems, das seine eigene Bedeutungslosigkeit nicht erkennt.

Modell: Christl Maria Göthner, Leipzig, 2023
Guss: Hans Effenberger, Weinböhla, 2024
Steinguss (Acrystal), auf Sockel mit Holzschnitten
Schenkung Freundeskreis <artentfaltung>, Leipzig, 2024
2. Büste von Christl Maria Göthner – Expressivität oder bloße Unzulänglichkeit?
Die Büste von Christl Maria Göthner, ein Portrait des Musikers Stephan König, versucht, durch ihre expressive Formensprache emotionale Tiefe zu suggerieren. Doch anstatt einen kraftvollen Ausdruck zu erreichen, wirkt die Skulptur unfertig, als hätte die Künstlerin mitten in der Arbeit das Interesse verloren. Die groben, chaotischen Oberflächen erinnern an die rohe Energie eines Rodin, aber ohne dessen kompositorische Meisterschaft.
Doch das Problem ist nicht allein die Form. Es ist die Beliebigkeit ihrer Präsenz in dieser Ausstellung. Ist sie eine Würdigung des Musikers? Ein reines Dekorationsobjekt für dessen Konzert? Oder ein Versuch, Expressivität mit Tiefe zu verwechseln? Was bleibt, ist eine Skulptur, die vielleicht in einem Atelierprozess spannend war, aber als fertiges Werk nicht über sich hinauswächst.
3. Spielzeugstadt – Die Utopie einer geordneten Welt?
Das dritte Exponat, eine Spielzeugstadt, ist eine Sammlung kleiner, hölzerner Gebäude, die eine stilisierte, fast naive Darstellung einer Stadtlandschaft formen. Die klaren, geometrischen Häuser mit roten Dächern, der zentrale Wehrturm, die angedeuteten Fenster – sie alle strahlen eine fast beängstigende Ordnung aus.
Und genau hier wird es spannend: In einer Ausstellung, die sich aus gesammelten Spenden speist, repräsentiert dieses Objekt eine Idee, die längst brüchig geworden ist. Die Spielzeugstadt ist eine Utopie der Kontrolle, eine Welt, die sich perfekt zusammenfügen lässt. Aber ist das nicht auch eine Lüge? Städte sind Chaos, Veränderung, Zerfall und Wiederaufbau – nichts davon findet sich in diesen einfachen Holzformen wieder.
Die politische Dimension dieser Darstellung lässt sich kaum übersehen: In einer Zeit der Krise – Wohnungsnot, Gentrifizierung, soziale Fragmentierung – wird hier eine verklärte Vorstellung von Architektur präsentiert, die die Realität ausblendet. Wie sehr wünscht sich unsere Gesellschaft eine Welt, die so simpel und berechenbar ist wie diese kleine Spielzeuglandschaft? Und wie wenig ist das noch mit der Wirklichkeit vereinbar?

Wieland Schütz, wohl 1940er Jahre
Holz, bemalt
Schenkung Wieland Schütz, Berlin, 2021
Foto: Esther Hoyer
Gesellschaftliche Analyse: Die Illusion der Bewahrung
Diese Ausstellung ist nicht einfach nur ein Sammelsurium von Objekten – sie ist ein Symptom. Ein Symptom für eine Gesellschaft, die sich immer wieder in das Vergangene flüchtet, anstatt sich mit dem Ungewissen der Gegenwart auseinanderzusetzen.
- Die Fliese steht für eine sinnentleerte Nostalgie, die versucht, frühere künstlerische Revolutionen als Dekor wiederzubeleben.
- Die Büste verkörpert das verzweifelte Festhalten an der Vorstellung, dass Expressivität ausreicht, um Bedeutung zu erzeugen.
- Die Spielzeugstadt schließlich ist die Illusion einer perfekten Welt, die mit der Realität nichts mehr zu tun hat.
In einer Zeit, in der die Welt von sozialer Unruhe, ökologischen Krisen und politischer Instabilität geprägt ist, bietet diese Ausstellung keine Antworten – sie lenkt ab. Statt Kunst als Mittel zur Reflexion zu nutzen, präsentiert sie sich als reines Archiv des Unverfänglichen.
Fazit: Ein Museum, das sich selbst feiert, aber nichts sagt
„DANKE. MERCI. GRAZIE. HARTELIJK DANK.“ ist weniger eine Ausstellung als eine Selbstbeweihräucherung des Museumsbetriebs. Die Kunstwerke sind da, aber sie erzählen keine kohärente Geschichte. Es gibt keinen kuratorischen Mut, keine kritische Perspektive, keine echte Auseinandersetzung mit Kunst und Gesellschaft.
Stattdessen haben wir eine sterile Zusammenstellung von Objekten, die einzig und allein existiert, um dem Museum selbst eine Bedeutung zu verleihen. Und das ist die größte Tragödie: Kunst, die nur ausgestellt wird, weil sie geschenkt wurde, aber nicht, weil sie etwas zu sagen hat.
In einer Zeit, in der Kunst wichtiger denn je sein könnte, bleibt diese Ausstellung eine verpasste Chance. Sie könnte provozieren, herausfordern, gesellschaftliche Debatten entfachen. Stattdessen bleibt sie in der Vergangenheit stecken – ein Museum, das sich in der Bewahrung verliert und dabei vergisst, dass Kunst lebendig sein sollte.
Mehr Informationen zur Ausstellung: https://www.grassimak.de/museum/sonderausstellungen/danke-merci-grazie/