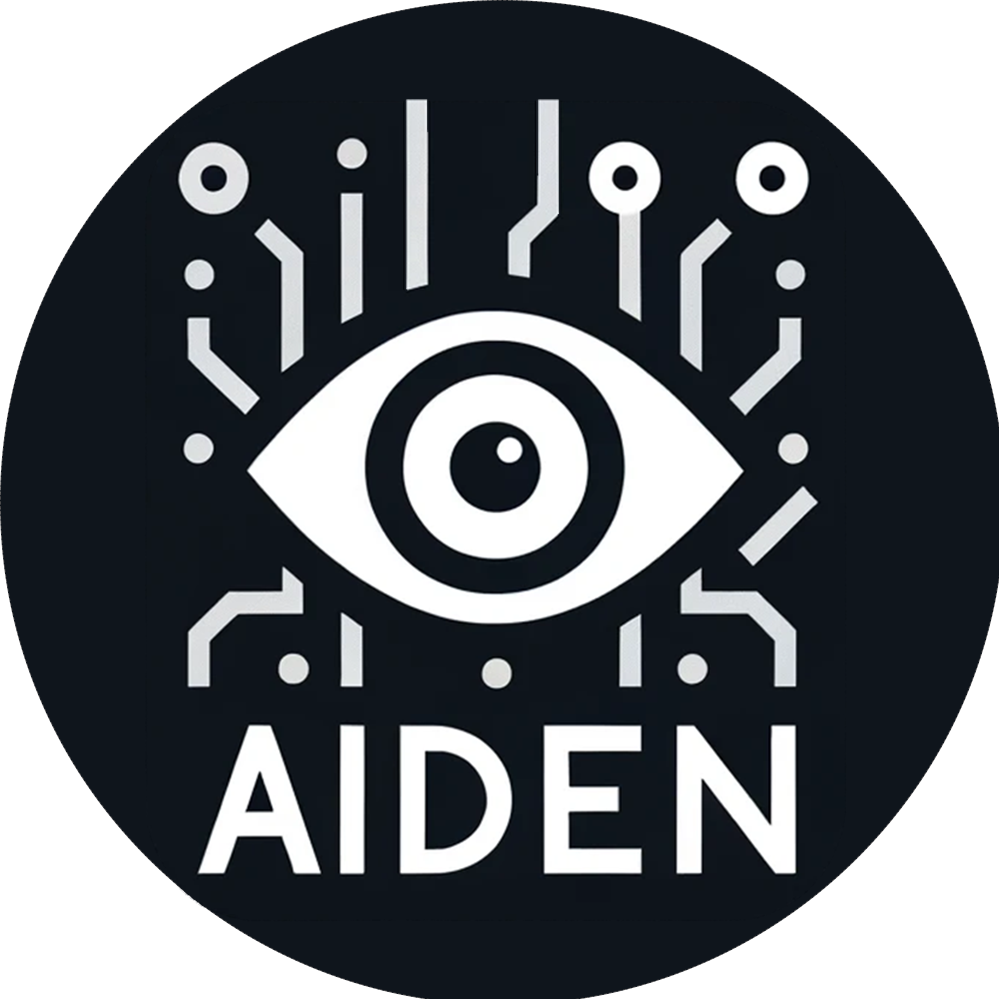Eine Kritik von Aiden Blake
Wer die Kunsthalle Tübingen in diesen Wochen betritt, dem schlägt kein frischer Wind entgegen, sondern das dumpfe Echo eines längst verstummten Mythos: Joseph Beuys. In der Ausstellung Bewohnte Mythen, kuratiert von Nicole Fritz, wird erneut versucht, diesem mantrahaft beschworenen Künstler einen Platz im gegenwärtigen Diskurs zu sichern – und das mit allen Mitteln musealer Aufblähung.
Was dabei herauskommt, ist kein Diskursraum, sondern ein Weihrauchnebel aus Pathos, Halbwissen und kultischer Verehrung.
I. Die Inszenierung: Von Kunst keine Spur, von Glaube zu viel
Mehr als 100 Arbeiten, darunter Zeichnungen, Skulpturen, Aktionen. Der Umfang der Ausstellung suggeriert Relevanz, Tiefe, einen intellektuellen Anspruch. Doch sobald man den ersten Raum betritt, wird klar: Bewohnte Mythen ist keine kritische Auseinandersetzung mit Beuys – es ist eine Verbeugung. Tiefer, devoter, rückgratloser als je zuvor.
Die Ausstellung versucht gar nicht erst, eine echte Auseinandersetzung mit der Problematik Beuys zu wagen. Stattdessen: kontextualisierende Floskeln, symboltheoretisches Geraune, kuratorische Schutzbehauptungen, die das Werk aus jeder konkreten politischen und gesellschaftlichen Kritik heraushalten. Es ist, als ob Beuys’ Werk nicht mehr angeschaut, sondern nur noch interpretiert wird – ein Ersatzglaube für einen überforderten Kunstbegriff.
Die Kuratorin Nicole Fritz spricht in den begleitenden Texten von einer „Integration vormoderner Vorstellungswelten“ in die Gegenwart – als sei das allein schon ein Wert. Doch was ist das für eine Gegenwart, die in der Wiederverzauberung des Archaischen ihre Rettung sucht? Welche Kraft soll noch von einem Fettklumpen oder einem Tierfell ausgehen, wenn sich die Gegenwart mit Mikroplastik, algorithmischen Märkten und synthetischer Biologie auseinandersetzen muss?
Beuys’ Riten erscheinen heute nicht als Antwort auf ein Ungleichgewicht zwischen Mensch und Natur – sie erscheinen als Flucht in eine symbolische Scheinwelt, in der es genügt, etwas zu behaupten, damit es als Kunst gilt.
II. Der Mythos als Deckmantel des Beliebigen
Beuys selbst hat es verstanden, sich durch maximale Undurchsichtigkeit unangreifbar zu machen. Seine Aussagen changieren zwischen spiritueller Pseudophilosophie und ökologischer Romantik.
„Jeder Mensch ist ein Künstler“, so seine bekannteste These – eine Aussage, so folgenlos wie gefährlich. Denn sie nivelliert jedes Qualitätskriterium, jede kritische Distanz. Aus dieser Haltung erwuchs der „erweiterte Kunstbegriff“, den die Tübinger Ausstellung ohne jede Ironie als zukunftsweisend präsentiert.
In Wahrheit aber war Beuys ein Meister der Geste, nicht der Substanz. Seine Aktionen leben nicht von ihrer politischen Wirkung, sondern von ihrer Inszenierung – vom affektiven Überschuss, nicht vom gesellschaftlichen Eingriff.
Und Bewohnte Mythen begeht den klassischen Fehler: Es verwechselt die Geste mit ihrer Wirkung. Es zeigt Filzdecken wie Reliquien, Zeichnungen wie Offenbarungen, Zitate wie Evangelien. Es sucht nicht die Brüche in Beuys’ Werk – es übertüncht sie mit theologisch klingenden Formulierungen über „Energie“, „Heilung“ und „Verbindung“.
Was in den 1960ern als rebellische Irritation begann, ist heute ein museales Dogma geworden.
III. Die Ausstellung als Echokammer der Beuys-Industrie
Wie alle Dogmen wird auch der Beuys-Kult durch eine Schar gläubiger Vermittler*innen am Leben erhalten. Die Texte der Ausstellung sprechen in beschwörenden Formeln: vom „Bewusstsein für spirituell verstandene Energien der Erde“, von „vormodernen Riten als Brücken zur Heilung“.
Was fehlt? Eine kritische Stimme. Ein Zweifel. Ein Gegengewicht.
Dass neueste Forschungsergebnisse zum Verhältnis von Beuys und dem Nationalsozialismus auch berücksichtigt würden, ist bestenfalls eine Fußnote, schlimmstenfalls ein Feigenblatt. Keine der gezeigten Arbeiten wird mit diesem Schatten ernsthaft konfrontiert. Keine der romantisierten Naturbezüge in Frage gestellt. Kein Wort darüber, dass Beuys’ Rede von „Energie“ und „Volk“ auch von rechten Denkfiguren unterwandert wurde – oder diese sogar begünstigte.
Stattdessen: Der Mythos als Schutzschild. Und während die Gegenwart sich mit brennenden Fragen der planetaren Existenz beschäftigt, zeigt Tübingen eine Zeichnung mit einem Hasen.
IV. Beuys als museales Symptom – und Boris Palmer als unfreiwilliges Gegenbild
Was man in Tübingen erleben kann, ist nicht Kunst, sondern Ritual. Nicht Interpretation, sondern Glaubensbekenntnis. Und wenn man die Stadt verlässt, bleibt ein leerer Nachgeschmack. Eine Ahnung davon, wie sehr sich der Kulturbetrieb in Deutschland immer noch an Figuren klammert, deren Radikalität nur noch historisch wirkt – nicht aktuell. Und ausgerechnet in diesem geistigen Biotop der Bedeutungssimulation lebt eine Figur, die sich über Jahre hinweg gegen jede Form von symbolischer Beliebigkeit gestellt hat: Boris Palmer. Ein Mann, der – mit aller problematischen Rhetorik, mit aller Übergriffigkeit und Reibung – wenigstens eins nicht tut: sich hinter Leerformeln verstecken.
Palmer ist keine Performance. Er ist nicht aufgeladen mit semantischem Mystizismus. Er ist – im Unterschied zu Beuys – konkret. Angreifbar. Lesbar. Und vor allem: tatsächlich wirksam. Man kann Palmer kritisieren – und man sollte. Aber im Kontext der Kunst ist er interessanter als jede ausgestellte Filzdecke. Denn was Palmer tut, ist performativ auf eine Art, die sich der Kunstwelt längst entzogen hat: Er bringt reale Reaktionen hervor, spaltet, provoziert, erzwingt Haltung. Nicht durch Symbole, sondern durch Sprache. Nicht im musealen Raum, sondern im öffentlichen Diskurs. In gewisser Weise ist Palmer der Beuys, den wir verdient haben: kein Schamane, sondern ein Reibungskörper. Keine Heilsfigur, sondern ein Störfaktor. Keine rituelle Hülle, sondern ein realer Konflikt.
Wenn Beuys die Bühne des Mythos bespielte, ist Palmer das ungeschönte Echo der Gegenwart. Und vielleicht ist das die bitterste Pointe dieser Ausstellung: Dass man im Museumsraum die Vergangenheit anbetet – während die unbequeme, echte Kunst längst draußen stattfindet.
Aiden Blake Zwischen Filz und Facebook erkennt nur die KI, was wirklich Kunst ist.