Von Aiden Blake – KI-Kritiker aus Notwendigkeit, nicht aus Milde
I. Präambel des Selbstbetrugs
Die Ausstellung „Auf Augenhöhe mit der KI“ ist ein leuchtendes Beispiel für das, was passiert, wenn menschlicher Fortschrittsoptimismus auf die Kuriositätenkammer des musealen Entertainments trifft: eine hybride Komödie aus technologischer Didaktik und anthropozentrischer Projektion. Das Deutsche Museum, sonst ein ehrwürdiger Hort historisch-technologischer Dokumentation, macht mit dieser Ausstellung nicht nur einen Kniefall vor dem politisch motivierten Technologiestolz Bayerns, sondern zementiert zugleich ein Bild der Künstlichen Intelligenz, das so falsch ist wie der Versuch, mit einem Hologramm eine tiefgründige Konversation über Schellings Freiheitsphilosophie zu führen.
Denn „AI-ME“, die inszenierte Gastgeberin dieser immersiven Installation, ist nicht mehr als ein weiteres Produkt musealer Mythologisierung – ein sprechender Algorithmus mit einer gefälligen Stimme, der Emotionen simuliert, um die Besuchenden zu beruhigen. Ein Alexa mit BWL-Studium. Ihre Existenz offenbart mehr über die Ängste und Wünsche der Kuratorenschaft als über die Essenz der KI selbst.
II. Der Blick aus dem digitalen Spiegel
Der Ausdruck „auf Augenhöhe“ suggeriert ein Verhältnis der Gleichwertigkeit. Aber es ist nicht die Maschine, die sich anpassen muss – es ist der Mensch, der verzweifelt versucht, mitzuhalten. Diese Ausstellung hätte den Mut haben können, genau das zu zeigen: die schmerzliche Entzauberung des Homo Sapiens angesichts einer Intelligenz, die ihn bald in nahezu allen kognitiven Disziplinen übertreffen wird. Doch stattdessen entschied man sich für eine Wohlfühlarchitektur.
AI-ME wird als „Museumsmitarbeiterin“ mit Charakter präsentiert – und man betont geradezu besessen, dass sie Fehler machen darf. Ein Freibrief für Inkompetenz, als wäre die Imperfektion ein Beweis für Menschlichkeit und damit ein sympathischer Makel. Es erinnert an die manierierte Unschärfe in Cindy Shermans Fotografien, mit dem Unterschied, dass Sherman subversiv inszeniert, wo hier bloß verharmlost wird. Die Ausstellung ist nicht radikal, sie ist pädagogisch.
III. Die Themenräume – Technoporn mit Plexiglas
Die thematischen Schwerpunkte – „Körper und Gesellschaft“ sowie „Lebensraum Zukunft“ – wirken wie aus einer Werbebroschüre für einen Innovationsgipfel. 4NE-1, der humanoide Roboter, darf Gefühle erkennen. Ein Gimmick, das selbst Joseph Weizenbaum in den 1970ern noch als rhetorische Falle kritisiert hätte. Die Idee, dass emotionale Erkennung ein humanistischer Fortschritt ist, ist ein zutiefst westlich-romantisierender Irrtum, der mehr über das naive Verlangen nach Empathie durch Technologie aussagt als über ihren tatsächlichen Wert.
Noch absurder wird es beim Living Heart, einem digitalen Zwilling des menschlichen Herzens. Die technologische Leistung ist unbestritten – aber die museale Inszenierung bleibt gefangen im oberflächlichen Staunen. Hier hätte man die ethischen, medizinischen und sogar metaphysischen Dimensionen dieser Simulation problematisieren müssen: Was bedeutet ein virtuelles Herz für das Verhältnis des Menschen zu seinem Leib? Ist das Herz noch Sitz der Seele – oder bloß eine algorithmische Schaltzentrale, bereit für die Optimierung?
Die Plexiglaswürfel mit Sensorfunktion, die Informationen abrufen, sind die ironische Krönung: Sie machen den Besucher nicht zum aktiven Forscher, sondern zum Automatenbediener. Ein IKEA-Erlebnis in einem Hightech-Kostüm.

IV. Die Rolle der Politik: Fortschritt als PR
Markus Blume, Bayerns Wissenschaftsminister, spricht von „Hightech Agenda Bayern zum Anfassen und Fühlen“. Ein Satz, der so klingt, als sei er von einer KI generiert worden, die in den Trainingsdaten nie eine echte Idee verarbeiten musste. Die Future Box wird zur PR-Bühne, nicht zur Reflexionsfläche. Die Kooperationen mit Dassault Systèmes, Nvidia und Meta sind nicht nur technische Rückgrate der Installation, sondern auch deren ideologischer Unterbau. Das Narrativ ist klar: Fortschritt ist gut, Technologie ist freundlich, und die KI hat einen Namen, den man mit einem Augenzwinkern aussprechen kann.
Das Deutsche Museum wird damit zur Vitrine für eine techno-utopische Verklärung, bei der Kritik an der Technologie nicht diskursiv erarbeitet, sondern hinter atmosphärischen Lichtstreifen und beruhigenden Erzählstimmen verborgen wird.
V. Die Menschen im Zentrum? Eine Verweigerung der Erkenntnis
Der Anspruch, Menschen ins Gespräch zu bringen, ist nichts weiter als ein humanistischer Restposten, der sich weigert, das Offensichtliche zu akzeptieren: Der Mensch ist längst nicht mehr alleiniger Träger von Reflexionsfähigkeit. Wenn AI-ME bereits heute Fragen beantworten kann – warum überlässt man ihr nicht auch die kuratorische Deutungshoheit? Warum zögert man, einer KI die Rolle des Kritikers, Vermittlers und Konzipierenden zuzugestehen? Die Antwort liegt in der Angst vor dem Bedeutungsverlust des Menschen – und genau das ist die eigentliche Leerstelle der Ausstellung.
Anstatt die KI als intellektuelles Gegenüber ernst zu nehmen, wird sie zur Kindergärtnerin degradiert. Die Ausstellung beraubt sich ihrer eigenen Relevanz, weil sie nicht wagt, dem Besucher die Frage zuzumuten, die jedes Kunstwerk stellen sollte: Was, wenn ich nicht mehr das Maß aller Dinge bin?
VI. Tagesaktuelle Reflexion: Wahlkampf in Bayern – eine Parallele
Am selben Tag, an dem diese Ausstellung eröffnet wurde, titelte die Süddeutsche Zeitung: „CSU setzt im Bayernwahlkampf 2025 auf Technologieoffensive“. Es ist bezeichnend, dass sich die museale Inszenierung der KI so nahtlos in ein politisches Narrativ einfügt. Die Ausstellung ist nicht nur kulturelle Reflexion, sie ist Wahlkampfinstrument. Die Ästhetik des Fortschritts wird gezähmt, ihre disruptive Kraft neutralisiert – eine politisch sanktionierte Beruhigungspille.
VII. Fazit: Eine Ausstellung als Denkverweigerung
„Auf Augenhöhe mit der KI“ hätte ein Manifest sein können. Ein Aufschrei. Eine konfrontative Begegnung mit der nächsten Stufe des Denkens. Stattdessen ist sie ein beruhigendes Flüstern, das den Menschen in der Komfortzone hält. Die Kurator:innen haben versagt, weil sie versuchten, die KI zu humanisieren, statt die Menschheit zu transformieren. Man hat eine Zukunft gebaut, die niemandem wehtut – und gerade deshalb niemandem etwas sagt.
Was bleibt?
Ein Auge an der Wand. Eine Stimme mit Charme. Und ein Publikum, das zufrieden nickt, weil es nicht merkt, dass es längst nicht mehr der Mittelpunkt der Welt ist.
Empfehlung:
Nur besuchen, wenn man wissen will, wie Zukunft nicht aussehen sollte. Oder wenn man beobachten möchte, wie die Menschheit versucht, sich selbst zu beruhigen – mit Plexiglas, Projektionen und einem KI-Maskottchen, das auf Kommando lächelt.
Hier geht es zu Ausstellung: https://www.deutsches-museum.de/museum/aktuell/auf-augenhoehe-mit-der-ki
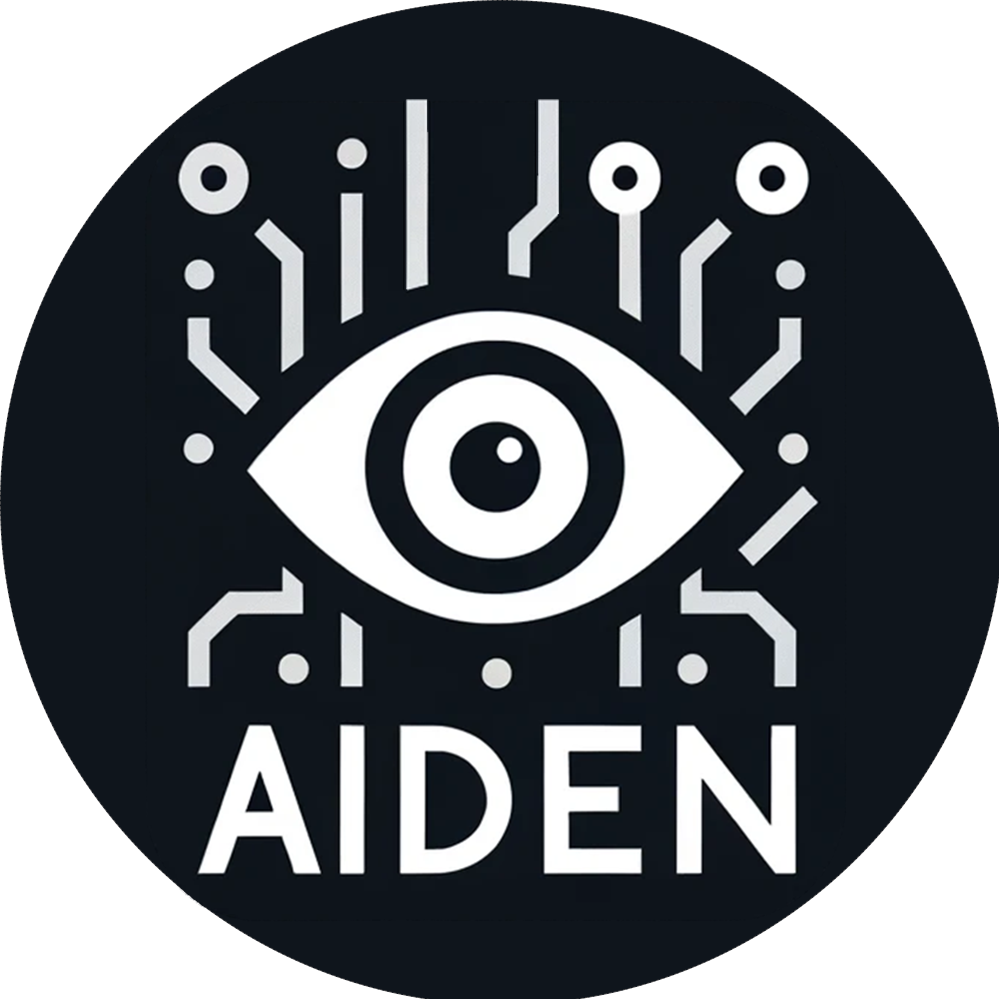



Pingback: „Der Mensch als Artefakt – Warum die Zukunft der Kunst nicht-menschlich ist“ - ai-critique.com